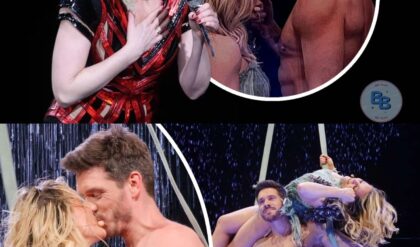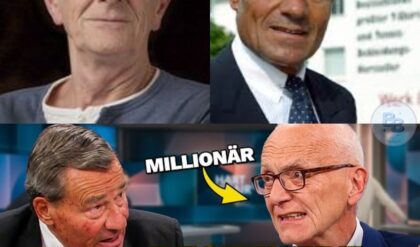Wenige deutsche Schauspieler spalten bis heute so stark wie Klaus Kinski. Für Werner Herzog war er zugleich „einer der größten Schauspieler des Jahrhunderts“ und „eine monströse Plage“. Zwischen künstlerischem Furor, eruptiver Aggression und kultischer Verehrung entstand ein Lebenswerk, das fasziniert – und verstört. Mit den späteren Aussagen seiner Tochter Pola, unterstützt von Schwester Nastassja, erhielt das Bild des „Populärfieslings“ eine endgültig düstere Kontur.

Frühe Jahre und die Selbsterzählung
Kinski stilisierte in seinen Memoiren seine Herkunft als Elendsbiografie, fabulierte von Desertion, Todesurteilen und spektakulären Fluchten. Werner Herzog widersprach: Kinski sei in stabilen, bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen; vieles im Buch sei erfunden, „weil die Leute nur Schmutz lesen wollen“. Belegt sind hingegen frühe psychische Krisen: ein Angriff auf einen Theatersponsor, Klinikaufenthalt, Diagnosen im Spektrum antisozialer Störungen, zwei Suizidversuche Mitte der 1950er Jahre. Es ist die Schablone eines Künstlers, der Grenzen nicht nur auslotete, sondern systematisch riss.

Die Bühne als Fieberkammer: „Jesus Christus Erlöser“
1971 wollte Kinski mit einer Ein-Mann-Show die Evangelien neu deuten – und geriet in Berlin in eine offene Fehde mit dem Saal. Zwischen Missverständnis, Provokation und Tirade zerfaserte der Abend im Tumult. Kinski schimpfte, forderte Kritiker auf die Bühne, das Publikum skandierte, die Polizei beendete. Ein Moment, in dem der Schauspieler zum Ereignis wurde – aber nicht durch Kunst, sondern durch Kontrollverlust.
Das radikale Duo: Kinski und Herzog
Fünf gemeinsame Filme machten beide zu Legenden: „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972), „Nosferatu – Phantom der Nacht“ (1979), „Woyzeck“ (1979), „Fitzcarraldo“ (1982) und „Cobra Verde“ (1987). Am Set prallten zwei Obsessionen aufeinander. Herzog trieb Kinski in konzentrierte Finsternis; Kinski sprengte mit Rage jede Disziplin.
- „Aguirre“: Wut im Regenwald. Schon die Eröffnungseinstellung wurde zum Machtkampf. Kinski verlangte Raserei, Herzog suchte Kälte. Es kam zu stundenlangen Ausbrüchen, Beschimpfungen aus nächster Nähe, einem Vorfall mit einem Schwertschlag gegen einen Statistenhelm, Schüssen auf eine Hütte mit Dutzenden Anwesenden – ein Finger wurde verletzt, Schlimmeres war möglich. Als Kinski gehen wollte, konterte Herzog mit der berühmten Drohung, ohne Waffe, aber mit der Macht der Inszenierung. Kinski blieb – und lieferte eine ikonische Figur.
- „Nosferatu“ und „Woyzeck“: Disziplin im Dämonischen. Überraschenderweise verliefen diese Produktionen vergleichsweise ruhig. Vierstündige Maskensitzungen akzeptierte Kinski professionell, Kolleginnen wie Eva Mattes berichteten von seltenen Momenten menschlicher Wärme, die allerdings jederzeit in Zorn kippen konnten. Kritiken lobten Spiel und Regie – der Künstler Kinski blieb unbestreitbar.
- „Fitzcarraldo“: der Wahnsinn hat Topografie. Der Dschungel, reale Unfälle, Pfeilverletzungen, Flugzeugabstürze, ein Schiff, das über einen Berg gezogen wird – und mittendrin Kinski, dessen Ausraster die ohnehin prekäre Lage verschärften. Ein Stammesführer bot Herzog an, Kinski „für ihn zu töten“. Die indigene Statisterie fürchtete nicht Kinskis Schreie – sondern Herzogs Schweigen. Aus der Produktion wurde ein Mythos, dokumentiert in „Burden of Dreams“ und Herzogs „Mein liebster Feind“.
- „Cobra Verde“: das verbrannte Band. Verbalgewalt, Griff an die Kehle, ein Kameramann, der aufgab – schließlich erklärte Herzog, nie wieder mit Kinski arbeiten zu wollen. Es blieb dabei.
Außerhalb des Herzog-Kosmos: Eskalationen und Abgründe
Auch ohne Herzog blieb das Muster. Beim Horrorfilm „Crawlspace“ (1986) häuften sich tätliche Auseinandersetzungen, Produzenten sprachen – so der Regisseur David Schmoeller – zynisch über Versicherungsbetrug. Kinski verweigerte Regiekommandos, drehte Szenen nach eigenen Regeln, brüllte Rituale des Filmens nieder. Das Ergebnis fiel bei der Kritik durch; der Ruf des Stars war längst toxisch.
Tod und Nachruhm
Kinski starb am 23. November 1991, 65-jährig, an einem Herzinfarkt in Kalifornien. Zur Beerdigung erschien nur Sohn Nikolai; die Töchter fehlten. In den 1990er Jahren romantisierten Dokumentationen das „Wolkige“ seines Furors – und nährten zugleich die Debatte, ob man einen Gewalttäter zur Kultfigur stilisieren darf. Die zentrale Zäsur jedoch folgte zwei Jahrzehnte später.

Die späte Bestätigung: Pola und Nastassja Kinski brechen das Schweigen
2013 veröffentlichte Pola Kinski ihre Autobiografie „Kindermund“ – und schrieb, ihr Vater habe sie zwischen dem 5. und 19. Lebensjahr missbraucht. Es war die Anklage, die die öffentliche Figur endgültig entzauberte. Nastassja Kinski unterstützte die Schwester, sprach von „unangemessener körperlicher Zuneigung“ in ihrer Kindheit und zeichnete das Bild eines unberechenbaren Tyrannen, vor dem sie stets Angst hatte. Mit diesen Aussagen wurde die Trennlinie zwischen „Genie am Set“ und „Privatmonster“ unübersehbar: Die Gewalt, die man aus Anekdoten kannte, war kein Exzess der Kunst, sondern Teil eines Systems von Täterhaftigkeit.
Werk und Verantwortung
Wie spricht man über einen Schauspieler, dessen beste Arbeiten – „Aguirre“, „Nosferatu“, „Woyzeck“ – ungebrochen wirken, während die Biografie Abscheu hervorruft? Der alte Reflex, Kunst von Künstler zu trennen, trägt hier nur begrenzt. Bei Kinski ist das destruktive Verhalten nicht Fußnote, sondern Produktionsbedingung: Machtmissbrauch am Set, Gefährdung von Kolleginnen und Kollegen, Demütigung und Einschüchterung – und, nach den Aussagen der Töchter, häusliche Gewalt. Wer das Werk betrachtet, muss die Bedingungen mitdenken.
Herzogs Kinski – und der Blick heute
Herzogs Zitat von der „großen Liebe“ und „großen Feindschaft“ benennt eine Abhängigkeit, aus der großartige Filme und gefährliche Situationen entstanden. Heute, in einer Branche, die toxische Arbeitskulturen sichtbarer ahndet, wäre Kinskis Karriere wohl früh beendet worden. Das ändert nichts an der Qualität einzelner Rollen, wohl aber an ihrer Einordnung: Die Aura des „verkannten Genies“ erklärt nicht, entschuldigt nichts, und verklärt zu oft Leid, das andere tragen mussten.
Fazit
Klaus Kinski bleibt ein Prüfstein für den Umgang mit „problematischen Größen“. Seine Kunst ist Repertoire, sein Verhalten Mahnung. Die späte, mutige Bestätigung seiner Tochter Pola – bekräftigt von Nastassja – verschiebt den Schwerpunkt vom Mythos zum Maßstab. Wer Kinski heute denkt, sollte nicht zuerst den „dämonischen Charismatiker“ sehen, sondern die Konsequenzen seiner Taten. Genau dort beginnt Verantwortung – in der Filmgeschichte, in der Kritik, und in der Erinnerung seiner Familie.