Die eiskalte Wahrheit der “Durchhaltefähigkeit”: Wie eine 19-Jährige Minister Pistorius’ Kriegsrhetorik mit einem viralen Satz demontiert.
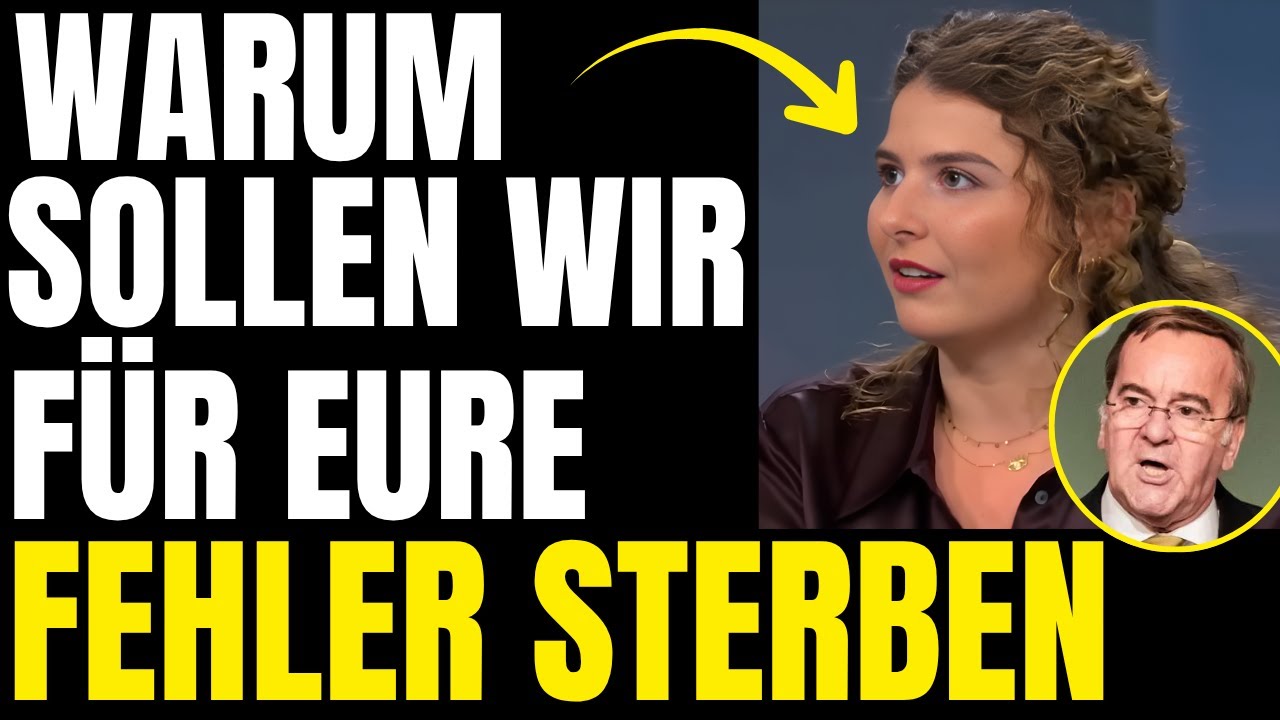
Article: Die eiskalte Wahrheit der “Durchhaltefähigkeit”: Wie eine 19-Jährige Minister Pistorius’ Kriegsrhetorik mit einem viralen Satz demontiert.
Deutschland befindet sich in der Epoche der sogenannten „Zeitenwende“. Angesichts der Rückkehr eines großen Krieges nach Europa, so die offizielle Lesart, muss die Bundesrepublik „kriegstüchtig“ werden. Unter der Führung von Verteidigungsminister Boris Pistorius wird dieser tiefgreifende Kurswechsel vorangetrieben, der nicht nur Milliarden in die Bundeswehr pumpt, sondern auch die gesamte Gesellschaft in den Dienst der Verteidigung stellen soll. Doch inmitten dieser politischen und logistischen Vorbereitungen hat ein einziger, gnadenloser Satz einer 19-jährigen Studentin die nüchterne Debatte abrupt zum Stillstand gebracht und die eiskalte Realität der Kriegsplanung ungeschminkt offenbart.
Die jungen Menschen, die in diesen strategischen Planspielen als “die Nächsten” auftauchen, haben eine moralische Dimension in die Diskussion eingebracht, die die Politik bislang zu ignorieren versuchte. Ihre Worte sind nicht nur viral gegangen; sie sind eine Anklage gegen eine Generation von Politikern, die über Frieden reden, während sie die Infrastruktur für den nächsten Konflikt vorbereiten und die Last des Scheiterns auf die Schultern der Jugend legen.
Die explosive Definition der „Durchhaltefähigkeit“
Der zentrale, schockierende Moment der Diskussion drehte sich um das militärische Konzept der „Durchhaltefähigkeit“ der Bundeswehr. Während Fachleute diesen Begriff in strategischen und logistischen Dimensionen verorten, lieferte die junge Frau, Tuba Inan, eine zutiefst menschliche und brutale Übersetzung der militärischen Fachterminologie.
Die Antwort erfolgte auf die Frage, wer denn die Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr gewährleisten solle. Die klare und erschreckende Antwort: die Jahrgänge, die ab 2008 geboren wurden. Die 19-Jährige konterte direkt mit einem Satz, der die gesamte Runde für einen Moment einfrieren ließ: „Durchhaltefähigkeit bedeutet, wenn die erste Riege stirbt, dann schicken wir die nächste nach. Das bedeutet Durchhaltefähigkeit.“
Dieser Satz sprengte die rhetorischen Schutzwälle der Debatte. Er machte klar, dass es bei der hochgestochenen Rede von Verteidigungsfähigkeit und nationaler Sicherheit im schlimmsten Fall um das nackte Sterben junger Menschen geht, die gerade erst volljährig geworden sind. Der Moderator/Kommentator brachte es auf den Punkt: Wenn Politiker gezwungen sind, zu erklären, warum man keine Angst haben muss, dann ist dies fast immer ein schlechtes Zeichen. Die Offenheit der jungen Generation entlarvt das „Schutzwall-Gerede“ der Etablierten als den Versuch, eine unbequeme Realität schönzureden.
Die Angst vor der totalen Militarisierung der Gesellschaft
Die Sorge der jungen Generation geht jedoch über die reine Personalführung im Kriegsfall hinaus. In der Diskussion wurde deutlich, dass die “Zeitenwende” bis in die feinsten Fasern des gesellschaftlichen Lebens vordringt und die gesamte Infrastruktur umbaut. Eine Teilnehmerin berichtete von Haushaltsausschüssen, in denen offen über die Notwendigkeit gesprochen wird, die Brückenfunktionstüchtig zu machen, „damit Panzer darüber fahren.“
Es geht um die tiefgreifende Militarisierung des zivilen Lebens. Krankenhäuser sollen umgerüstet werden; die Bundeswehr hält Einzug in die Schulen. Diese Entwicklungen führen bei vielen Menschen zu berechtigten Ängsten. Man hat das Gefühl, dass die gesamte Gesellschaft auf Krieg ausgerichtet wird, während man gleichzeitig mantraartig vom Frieden spricht. Diese Widersprüchlichkeit erzeugt nicht nur Verwirrung, sondern ein tiefes Misstrauen gegenüber der politischen Führung, die die Öffentlichkeit auf einen Kurswechsel einschwören will, der bis zur Umgestaltung ziviler Infrastruktur reicht. Es scheint, als würde der Krieg zu einem logistischen Problem erklärt, das mit Bauplänen und Richtlinien gelöst werden kann, anstatt mit politischen oder diplomatischen Mitteln abgewendet zu werden.
Der Staat greift nach den sensitiven Daten der Jugend
Besonders kontrovers ist der Vorstoß des Staates, über verpflichtende Fragebögen und Musterungen junge Menschen, die im Jahr 2008 geboren wurden, zu erfassen und ihre Eignung zu bewerten. Ms. Inan kritisierte diese Maßnahme als einen „Warnwitz“ und als „pervers“. Es handelt sich um junge Menschen, die zum Zeitpunkt der Geburt 2008 im Moment der Debatte gerade einmal 16 oder 17 Jahre alt sind – „diese Kinder sind da erst geboren“. Und nun sollen sie ihre „Muskelkraft und Kondition“ im Vergleich zu ihren Altersgenossen einschätzen.
Der Kern der Kritik richtet sich gegen den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Erhebung sensibler Daten. Bezugnehmend auf das diskutierte schwedische Vorbild listete Ms. Inan Fragen auf, die der Staat aus ihrer Sicht schlicht nichts angehen: Fragen wie „wie gut gehst du mit Stress um?“, „befolgst du üblicherweise die Anweisungen deiner Lehrer?“ oder ob man schnell wütend wird oder die Kontrolle verliert. Die Erfassung von Gesundheitsdaten, die während der Coronazeit große Debatten auslöste, wird nun stillschweigend für militärische Zwecke akzeptiert.
Die Befürchtung ist, dass der Staat nicht nur Informationen sammelt, sondern die Jugendlichen bewertet, um ihre Verwertbarkeit für die Nation festzustellen. Die Idee, dass ein 16-jähriger Mensch vor eine Kommission treten muss, um begutachtet zu werden, ob er „verwertbar“ ist, empfinden viele als eine zutiefst beunruhigende und entmenschlichende Vorstellung. Es ist die Angst, dass die Jugend als bloßes Humankapital in einem System betrachtet wird, das im Ernstfall „Ersatzteile“ benötigt.
Die moralische Abwehr der jungen Generation
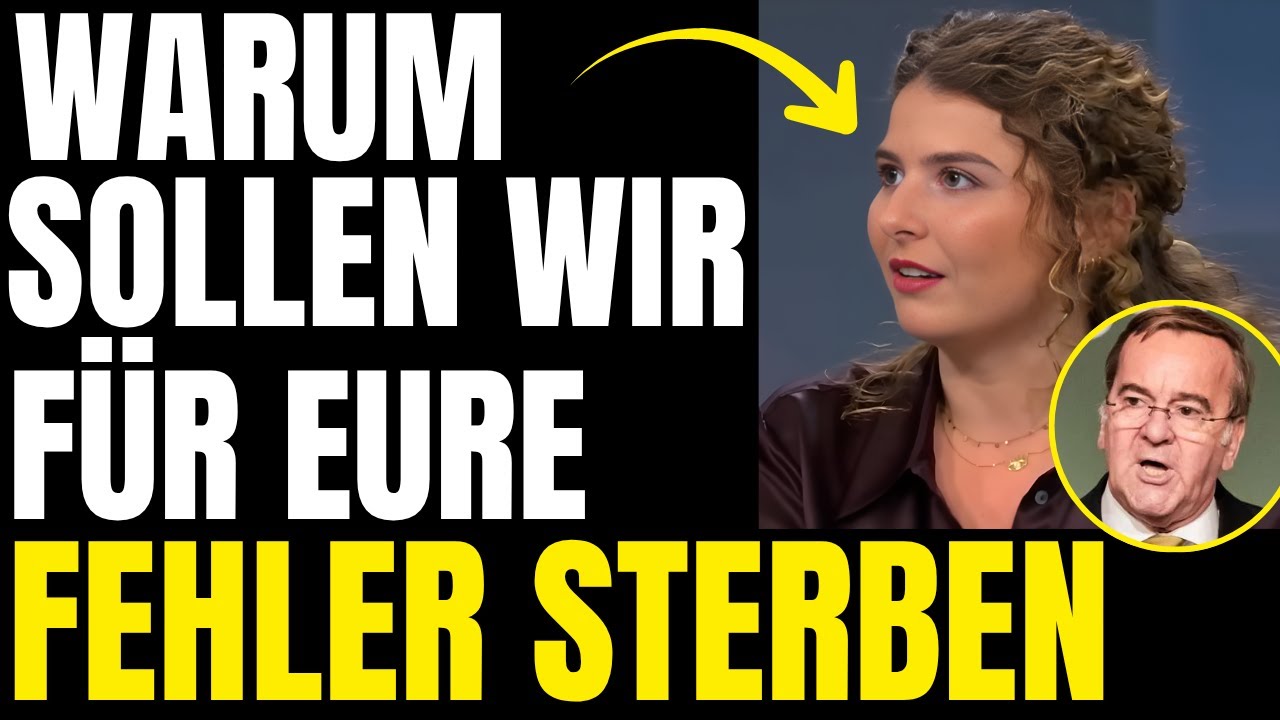
Hinter der logistischen Kritik am Fragebogen steht die fundamentale moralische Abneigung. Die jungen Menschen in der Runde artikulierten klar, warum sie den Wehrdienst ablehnen, selbst wenn er „freiwillig“ sei. Eine 19-jährige Freiwillige, die ein soziales Jahr leistet, erklärte, dass für sie der ausschlaggebende Punkt sei, dass sie „im Kriegsfall andere Menschen verletzen oder sogar umbringen“ müsste, was ihren Moralvorstellungen widerspräche. Zudem bestehe das Risiko, ihr „eigenes Leben im Extremfall zu riskieren.“
Ms. Inan betonte diesen Punkt nochmals, indem sie es als einen „Albtraum“ bezeichnete, sich ihr nahestehende Männer in olivgrüner Uniform vorzustellen. Sie stellte die rhetorische Frage, warum es erklärungsbedürftig sei, dass man seine Liebsten nicht an einem Ort wünscht, an dem sie „Menschen verletzen, Menschen töten, selbst verletzt werden, selbst töten“ und traumatisiert zurückkommen könnten.
Der männliche Gesprächsteilnehmer versuchte, die moralische Dimension zu retten, indem er betonte, die Bundeswehr sei nicht dafür da, Krieg zu führen, sondern um den Frieden zu bewahren – so wie im Kalten Krieg. Die moralische Dimension sei die Bewahrung von „Freiheit und Recht und Würde und Frieden“. Doch für die junge Generation, die täglich mit der Vorstellung konfrontiert wird, selbst die „nächste Riege“ zu sein, scheint dieser Appell nur ein schwacher Trost angesichts der konkreten Bedrohung.
Die Krise der inneren Stabilität als politische Ausrede
Ms. Inan stellte in der Debatte auch die politische Rhetorik infrage, die Russland unterstellt, die deutsche Gesellschaft von außen und innen destabilisieren zu wollen. Sie konterte mit der kritischen Frage, wann denn diese Gesellschaft „sinnvoll organisiert, gerecht, friedlich“ gewesen sein soll.
Ihre Argumentation lautet: Es braucht gar nicht Wladimir Putin, um die Gesellschaft zu destabilisieren, da Deutschland innerlich schon immer instabil gewesen sei. Die Rede von russischer Zwietracht, die eine „schöne Eintracht“ auflösen wolle, sei weltfremd. Ms. Inan, die seit 30 Jahren „dabei“ ist, verneint die Existenz dieser schönen, gerechten und sozialen Gesellschaft. Dieser Einwurf ist ein wichtiger Punkt, da er die politischen Verantwortlichen zwingt, über die internen Missstände und Ungerechtigkeiten nachzudenken, anstatt alle Probleme auf äußere Einflüsse abzuschieben.
Die unausweichliche Last der Verantwortung
Die Diskussion um die „Kriegstüchtigkeit“ hat in der Debatte mit der Jugend ihre gefährlichste und ehrlichste Dimension erreicht. Sie zeigt, dass die Regierung zwar versuchen kann, Sicherheitsdebatten auf der Ebene von Verteidigungshaushalten, Drohnenabwehr und Fragebögen zu führen. Doch am Ende landen die Pläne immer wieder bei den jungen Menschen, die die Konsequenzen tragen sollen, die aus jahrzehntelangen politischen Versäumnissen und Fehlern resultieren.
Die 19-jährige Studentin hat mit ihrer viralen Aussage einen kritischen Punkt erreicht: Wenn die politische Führung der Bevölkerung nicht mehr die Gewissheit geben kann, dass ihre Kinder sicher sind und sie nicht als „zweite Riege“ in einem Krieg verheizt werden, dann ist das Vertrauen in die „Zeitenwende“ massiv erschüttert. Die Diskussionen über Brücken für Panzer und Kliniken für Kriegsfälle sprechen eine deutlich andere Sprache als die Beteuerungen, man wolle den Frieden bewahren. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Die Regierung plant die logistischen Strukturen für den Konflikt, aber die Jugend fordert die moralische Debatte über den Preis des Friedens. Die Frage, ob es in Ordnung ist, dass der Staat junge Menschen für diese Zwecke bewerten will, ist längst keine Frage der Logistik mehr, sondern eine zutiefst menschliche und ethische Auseinandersetzung, die Pistorius und die gesamte Regierung nicht länger ignorieren können.





