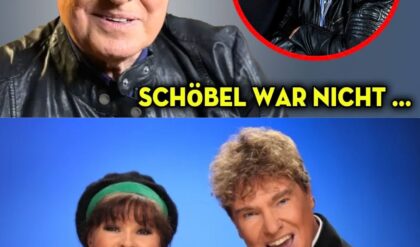„48 Stunden bis zum Stillstand? Wie realistisch ist die Drohung, China könne Deutschlands Wirtschaft in zwei Tagen lahmlegen?“
Als die Alarmmeldung in sozialen Netzwerken kursierte — „China kann Deutschland in 48 Stunden abschalten!“ — löste sie Panik, Entrüstung und zahllose Clickbait-Videos aus. Zwischen Überschriften, Emotionen und politischen Statements lohnt es sich, einen kühlen Blick auf die Fakten zu werfen: Welche Hebel hätte Peking überhaupt, welche Verwundbarkeiten sind real, und wie wahrscheinlich ist ein sofortiger, flächendeckender Wirtschaftsstillstand?
Kurzfassung der Recherche: China verfügt über reale Hebel, die bei gezielter Instrumentalisierung erhebliche Störungen auslösen könnten — insbesondere über Dominanz in bestimmten Rohstoffen und Vorleistungsindustrien sowie über Einfluss auf global vernetzte Liefersysteme. Das reicht jedoch nicht zwangsläufig aus, um eine Industrienation wie Deutschland binnen 48 Stunden vollständig „abzuschalten“. Was aber möglich ist, sind heftige, punktuelle und kostenintensive Schläge, die in empfindlichen Sektoren schnell spürbar würden. (European Central Bank)

Worauf stützt sich die Behauptung „48 Stunden“?
Die dramatische Zahl verweist auf zwei Arten von Hebeln: (1) physische Rohstoffe und Komponenten, deren Produktion und Verarbeitung stark in China konzentriert sind (z. B. Seltene Erden, Raffinationen bestimmter Mineralien), und (2) digital-infrastrukturbezogene Risiken (z. B. Cyberangriffe, Manipulationen in globalen Zahlungs- oder Logistiknetzen). Der Schlüsselpunkt: Wenn bestimmte Engpassgüter oder Infrastrukturen binnen Tagen gestört würden, könnten einzelne Industrien sehr schnell empfindliche Einbußen erleiden — besonders Bereiche mit „just-in-time“-Fertigung. Aber ein flächendeckender Zusammenbruch aller Wirtschaftssektoren in exakt 48 Stunden ist ein Szenario mit sehr hoher Zuspitzung, nicht eine analytisch gesicherte Prognose. (European Central Bank)
Rohstoffe: die Achillesferse der Hightech-Industrie
Deutschland ist technologisch hoch spezialisiert — Autos, Maschinenbau, Windturbinen, Industrieautomation. Viele dieser Produkte benötigen Komponenten oder Metalle, die durch Lieferketten laufen, bei denen China eine starke Rolle spielt. Besonders gefährdet sind sogenannt „Seltene Erden“ und spezialisierte Verarbeitungskapazitäten: China kontrolliert einen großen Anteil der weltweiten Produktion und Raffination dieser Stoffe, die für Magneten in E-Autos, Generatoren und bestimmte Halbleiter-Reinprozesse nötig sind. In jüngerer Zeit haben Institutionen wie die Europäische Zentralbank und Energieagenturen auf diese Konzentration hingewiesen und sie als reale Versorgungsrisiken eingeordnet. (European Central Bank)
Exportkontrollen und politisch motivierte Lieferstopps
Ein realeres, historisch belegtes Instrument ist die selektive Beschränkung von Exportsendungen oder die Einführung von Lizenzauflagen — Maßnahmen, mit denen China in der Vergangenheit Druck ausgeübt hat. Solche Maßnahmen können Produktion in einigen Wochen oder Monaten stark beeinträchtigen; in sehr engen Liefernetzwerken sind akute Engpässe sogar schneller spürbar. Beispiele und Analysen zeigen, dass China Instrumente der wirtschaftlichen Einflussnahme systematisch einsetzt — oft „hinter den Kulissen“. (European Parliament)
Kann China digitale Netze oder Energieinfrastruktur angreifen?
Cyberangriffe sind ein weiterer Hebel. Staatlich gestützte oder gut finanzierte Akteure können kritische Systeme angreifen — von Industrieanlagen bis zu Logistikplattformen. Deutschland hat mehrfach Schwachstellen in kritischer Infrastruktur benannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ein groß angelegter, koordinierter Cyberangriff könnte innerhalb Stunden oder Tagen schwere Störungen verursachen; ob er jedoch flächendeckend die gesamte Wirtschaft „abschaltet“, hängt von Verteidigungsmaßnahmen, Redundanzen und internationalen Hilfsnetzwerken ab. Zudem wäre ein solches Vorgehen geopolitisch extrem riskant und würde wahrscheinlich zu sofortigen Gegenreaktionen führen. (CSIS)
Beispiele für schon stattgefundene wirtschaftliche Druckmittel
China hat in der Vergangenheit Handelsmaßnahmen gezielt eingesetzt, um Druck auf Staaten auszuüben (auch wenn viele Fälle Asien-zentriert sind). In Europa wurden subtile Formen der wirtschaftlichen Einflussnahme identifiziert — von gezielten Verzögerungen bis zu indirekten Marktbarrieren. Solche Präzedenzfälle zeigen: wirtschaftlicher Zwang ist real — aber er erscheint in der Regel selektiv und zielgerichtet, nicht als völlige „Abschaltung“ einer ganzen Volkswirtschaft innerhalb von zwei Tagen. (Atlantic Council)

Deutsche Verwundbarkeiten — die realen Schwachstellen
- Seltene Erden & kritische Rohstoffe: Deutschland (und die EU) importieren einen großen Teil dieser Materialien aus China; hier bestehen echte Abhängigkeitsrisiken. (Clean Energy Wire)
- Halbleiter und Vorprodukte: Globale Engpässe bei bestimmten Vorprodukten können Fertigungsstraßen lahmlegen.
- Just-in-time-Fertigung: Produktion ohne große Lagerbestände reagiert sehr schnell auf Lieferunterbrechungen.
- Digitalvernetzung & Logistikplattformen: Störungen in digitalen Diensten oder in globalen Frachtnetzen (Häfen, Container) haben Kaskadeneffekte. (cer.eu)
Was Deutschland und Europa bereits tun — und was noch fehlt
Berlin und Brüssel haben das Risiko erkannt: Förderprogramme für Diversifizierung, ein Rohstofffonds, sowie Schritte zur Entkopplung kritischer Infrastrukturen (z. B. schrittweiser 5G-Restrukturierung) sind in Gang. Deutsche Verbände drängen auf schnelle EU-weite Lösungen, weil viele Unternehmen bereits Lieferengpässe melden. Dennoch ist der Aufbau von eigenen Raffinerie- oder Produktionskapazitäten teuer und zeitintensiv — darum bleibt das Risiko besonders in der Übergangszeit bestehen. (Financial Times)
Ein realistisches Worst-Case-Szenario — und wie plausibel ist es?
Ein Worst-Case könnte so aussehen: China verhängt strikte Exportkontrollen für mehrere kritische Bestandteile (z. B. bestimmte Metalle und Vorprodukte) und parallel dazu erfolgt ein umfangreicher Cyberangriff auf Logistikplattformen. Für besonders abhängige Branchen (z. B. bestimmte Zulieferer in der Autoindustrie) könnte das innerhalb von Tagen zu Fertigungsstopps führen. Für die Gesamtwirtschaft Deutschlands wäre ein kompletter Blackout in 48 Stunden jedoch extrem unwahrscheinlich — die ökonomische Struktur, Lagerbestände, Handelspartner außerhalb Chinas und staatliche Notfallmechanismen reduzieren diese Wahrscheinlichkeit. Was bleibt: starke, schmerzhafte Störungen in ausgewählten Sektoren mit kurzfristigen Kosten und mittelfristigen Lieferkettenverschiebungen. (European Central Bank)
Was kann die Bundesregierung tun — und was kann die Industrie tun?
Kurzfristig: Notfallpläne, strategische Lagerbestände für Schlüsselkomponenten, internationale Koordination (EU / G7) und Stärkung der Cyberabwehr. Mittelfristig: Investitionen in alternative Lieferquellen, Aufbau eigener Raffinations- und Fertigungskapazitäten, und stärkere Bündnisse mit like-minded Staaten, um kollektive Resilienz aufzubauen. Viele Experten betonen, dass allein nationale Maßnahmen nicht ausreichen — es braucht koordinierte, internationale Antworten, um die Hebelwirkung eines einzelnen großen Exporteurs zu neutralisieren. (CSIS)
Fazit: Alarmiert, aber nicht hilflos
Die Schlagzeile „China kann Deutschland in 48 Stunden abschalten“ ist eine starke Zuspitzung — aber sie berührt reale Probleme: Konzentration von Schlüsselressourcen, verwundbare Just-in-time-Produktionsketten und die Gefahr digitaler Angriffe. Deutschland steht vor einem ernsthaften Resilienzproblem, das kurzfristige Maßnahmen und langfristige strategische Investitionen erfordert. Panik nützt nichts — gezieltes Handeln schon. Die richtige Antwort ist nicht Verteufelung, sondern De-Risikierung: Diversifikation, Bündnisse, Lagerpolitik sowie technische und digitale Hardenings.