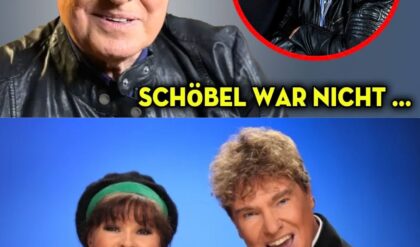„Sie verdiente Wahrheit“ – Daniel Biasini bricht sein Schweigen über Romy Schneider

Sie war die „ewige Sissi“ und zugleich eine der radikalsten Schauspielerinnen des europäischen Kinos: Romy Schneider, Leinwandkönigin, Tragödin, Ikone. Doch hinter den Bildern, Preisen und Schlagzeilen stand ein Mann, der ihr Leben aus nächster Nähe kannte – in den Höhen wie in den tiefsten Stürzen. Daniel Biasini, ihr zweiter Ehemann, hat über vier Jahrzehnte geschwiegen. Jetzt, mit 76 Jahren, spricht er – und zeichnet ein Bild, das leiser, menschlicher und schmerzhafter ist als die gängigen Mythen.
Vom Assistenten zum Anker
1973 begegnet der 24-jährige Presseattaché Biasini der bereits legendären Romy Schneider am Filmset. Aus professioneller Nähe wächst Vertrautheit; aus Vertrautheit ein unsichtbares Rettungsseil. Er organisiert Termine, schützt das Image – und hält in den schlaflosen Nächten die Hand. Romy, nach einer zerstörerischen Ehe erschöpft und im Sorgerechtskampf um Sohn David, findet in ihm das, was Ruhm nicht schenken kann: Ruhe. „Sie wollte keine Glamour-Show, sie wollte Frieden“, erinnert sich Biasini. 1975 heiraten beide still in West-Berlin. Kein Spektakel, keine großen Namen – nur das Versprechen, das Leben gemeinsam zu stemmen.
Das Glück bleibt fragil. Eine Fehlgeburt an Silvester 1975 stürzt Romy in Trauer. Zwei Jahre später bringt sie Tochter Sarah zur Welt – und für einen Moment scheint das Glück zu halten. Paris, Saint-Tropez, ein Haus voller Alltäglichkeit: Kochen, Gartenwege, Kinderlachen. Doch der Preis des Ruhms ist hoch. Romy dreht unermüdlich, Biasini beginnt, eigene berufliche Wege zu gehen. Distanz frisst die Nähe auf. 1981 zerbricht die Ehe – nicht im Hass, sondern in Erschöpfung, wie Biasini sagt: „Wir bluteten beide aus derselben Wunde.“
Der Nachmittag, der alles veränderte

Im Sommer 1981 ereignet sich die Katastrophe, die beider Leben zerreißt. David, Romys 14-jähriger Sohn, verunglückt tödlich, als er beim Übersteigen eines Eisentors stürzt. Biasini versucht zu retten, was nicht zu retten ist. „Man denkt, die Zeit heilt“, sagt er, „aber das stimmt nicht. Man lernt nur, das Gewicht zu tragen.“ Romy und Daniel trauern nebeneinander – vereint und doch zerrissen. Die Boulevardpresse zeigt keine Gnade, gestohlene Bilder kursieren, Gerüchte gedeihen. Für Romy, ohnehin gesundheitlich geschwächt, beginnt der letzte, stille Fall.
Ein Tod, der Fragen hinterließ
Am Morgen des 29. Mai 1982 hört Romy Schneiders Herz auf zu schlagen. 43 Jahre alt. Paris hält den Atem an, Europa spricht in Superlativen. Doch wo Erinnerung beginnen sollte, setzt Spekulation ein: Selbstmord? Überdosis? Die Ikone, sagen manche, habe die Abgründe gewählt, die sie so glaubwürdig spielte. Biasini widerspricht entschieden. Es sei kein Suizid gewesen, keine Dramaturgie des Untergangs. Romy habe nach einer großen Operation gelitten, sei finanziell belastet gewesen, vor allem aber von der Trauer um David erdrückt. „Ihr Herz blieb stehen“, sagt er – und meint damit mehr als eine medizinische Feststellung.
Gegen die Zerrbilder
Er tut, was er in all den Jahren getan hat: Er schützt. Die Beerdigung bleibt würdevoll, ohne Spektakel. Er hält die Paparazzi fern, so gut es geht. Als später Darstellungen kursieren, die Romy auf eine „tragische Diva“ reduzieren, geht Biasini an die Öffentlichkeit – selten, ungern, aber bestimmt. Er spricht von einer Frau, die lachte, kochte, barfuß durch den Garten ging; die ihre Kinder liebte und ihre Arbeit ernst nahm. Vor allem wehrt er sich gegen den Verdacht, sie habe ihren Sohn vernachlässigt. Eine Szene in einem späteren Film, in der Romy angeblich einen Anruf Davids ignoriert, nennt er „eine Schande“. „Niemals hat sie einen Anruf ihres Sohnes verpasst“, sagt er – und klagt, auch wenn er vor Gericht verliert. Geld ist ihm egal. Es geht um Würde.
„Die schöne Wunde“
Biasini baut sich ein stilles Leben auf, heiratet erneut, arbeitet im Hintergrund als Autor, Drehbuchschreiber, gelegentlich als Mentor für junge Schreibende. Im Arbeitszimmer hängen Fotos von Romy, von Sarah als Baby, von jenen Tagen, in denen das Glück zart und möglich schien. „La blessure belle“ – die schöne Wunde – nennt er sie. Ein Bild für eine Liebe, die nicht endet und doch keinen Trost verspricht. „Von Schmerz kommt man nicht zurück“, sagt er. „Man lernt nur, um ihn herum zu atmen.“
Sarah – das lebende Vermächtnis
/images/c6f92fca/b28f/45f0/9fce/cf2e67485a5c.jpg)
Tochter Sarah ist viereinhalb, als Romy stirbt. Ihre Erinnerungen sind Bruchstücke: ein Kuss am Beckenrand, Frühstück im Bett, der Duft eines Parfums. Aufwachsen mit einer Ikone als Mutter heißt für sie, von Fremden erkannt zu werden, als Trägerin eines Erbes, das zu groß ist für ein Kind. Sie entzieht sich Rollen, die sie zur Kopie der Mutter machen würden, sucht die eigene Stimme – vor allem auf der Bühne. Erst als Erwachsene beginnt sie, über die Mutter zu schreiben: nicht huldigend, nicht reißerisch, sondern in Form eines Briefes an die eigene Tochter. Ein Versuch, Romy nicht als Monument, sondern als Frau zu begreifen; die, die sie liebte und verlor, bevor sie sie kennenlernen konnte. Schreiben wird zu Trauerarbeit – und zur Öffnung eines Raums, in dem Erinnerung nicht zerstört, sondern verbindet.
Über ihren Vater spricht Sarah mit Respekt. Er habe nie gelogen, nie verklärt, nie verteufelt. Diese Haltung – die Menschlichkeit über das Spektakel zu stellen – zieht sich durch Biasinis Leben nach Romy. Er begleitet die Rezeption, liest Biografien, erträgt Bilder, die ihm wehtun, und bleibt dabei seiner Linie treu: „Erzählt die Geschichte, aber zerstört nicht den Menschen.“ Zwischen Wahrheit und Grausamkeit, sagt er, liege ein Unterschied, den die Öffentlichkeit zu oft vergesse.
Jenseits der Ikone
Das Bild, das aus Biasinis Worten entsteht, ist nicht das der tragischen Heiligen, auch nicht das der selbstzerstörerischen Diva. Es ist das Bild einer Frau, die viel lachte – „die Leute vergessen das“, sagt er –, die leidenschaftlich liebte, die in ihrer Kunst alles riskierte und im Privaten nach Halt suchte. Eine Mutter, deren Stärke nicht in Unverwundbarkeit lag, sondern in der Bereitschaft, trotz Verletzlichkeit weiterzugehen. Und eines Mannes, der es als seine Aufgabe begreift, diese Menschlichkeit zu verteidigen – gegen Gerüchte, gegen Projektionen, gegen die Gier nach Drama.
Ein spätes Wort zur rechten Zeit

Warum jetzt, nach so vielen Jahren? Vielleicht weil Schweigen irgendwann auch eine Form der Zustimmung wird. Biasinis späte Worte widersprechen nicht nur einem Boulevardnarrativ, sie erinnern an die Verantwortung derer, die erinnern. Nicht jede Lücke muss mit Spekulation gefüllt werden, nicht jedes Leid ist ein Stoff. Romy Schneider war, was sie auf der Leinwand zeigte: eine Künstlerin, die das Zerbrechliche ernst nahm – bei anderen und bei sich selbst. Dass ihr Herz stehen blieb, erklärt nichts und sagt doch alles über ein Leben an der Grenze zwischen Licht und Schatten.
Am Ende steht ein Satz, der wie ein Schlussakkord wirkt und der doch nichts beendet: „Sie verdiente Wahrheit. Sie verdiente Liebe.“ Biasini habe versucht, ihr beides zu geben. Vielleicht ist das die einzige Bilanz, die bleibt – für eine Frau, die mehr war als Rollen, mehr als Klatsch, mehr als ein früher Tod. Und für einen Mann, der gelernt hat, zu atmen, um den Schmerz herum.
Die Ikone bleibt. Aber hinter ihr wird wieder ein Mensch sichtbar. Genau das ist das Geschenk dieses späten, leisen Zeugnisses.