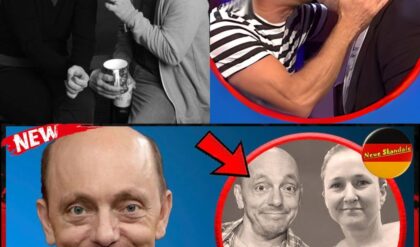Anna mit Messer und Schürze, Wilhelm mit einer Flasche Brandwein. Die Druckereien verdienten gut daran und bald erschien sogar eine kleine Broschüre, die den Fall als göttliche Warnung gegen Hochmut und Gutete. Doch nicht jeder sah in der Geschichte nur Sünde. In Hannover veröffentlichte ein junger Arzt, Dr.
Karl Wener, eine Schrift über pathologische Genusssucht, in der er Anna Hartmann als Beispiel für eine abnorme Verschmelzung von Sinnlichkeit und Grausamkeit beschrieb. Es war die erste medizinische Analyse, die das Verbrechen nicht nur moralisch, sondern psychologisch betrachtete. Er schrieb: “Sie suchte im Geschmack das Gefühl von Macht. Ihr Tun war keine Raserei, sondern Wissenschaft des Abgrunds. Das Publikum reagierte gespalten.
Die einen sahen darin Gotteslästerung, die anderen erkannten zum ersten Mal, dass das Böse nicht nur von Dämonen, sondern auch vom menschlichen Verstand kommen konnte. Imselben Jahr erließ das Königreich Preußen eine neue Verordnung. Jede Herberge musste ein vollständiges Gästeregister führen.
Jedes Gasthaus wurde regelmäßig kontrolliert. Fleischverkäufer mußten Herkunft und Menge dokumentieren und die Polizei erhielt erstmals das Recht, Räucherkammern zu prüfen. Der sogenannte Hartmann Erlass trat am 1. Juli 1880 in Kraft, doch selbst mit allen Gesetzen ließ sich die Angst nicht bannen. Die Menschen begannen, Fleisch mit Misstrauen zu betrachten.
In manchen Regionen Norddeutschlands sank der Fleischverbrauch über Jahre hinweg um beinahe ein Drittel. Stattdessen aß man Fisch, Eier, Brot, Dinge, deren Ursprung man sehen konnte. In Gesprächen hieß es: “Vertue nur dem, was du selbst gefüttert hast.” In der Region rund um das stille Tal entstanden seltsame Bräuche.
Wenn jemand Fleisch räucherte, schlug er dreimal mit einem Holzstab auf das Fass, um den Geist der Würze zu vertreiben. Frauen hängten kleine Kräuterbündel über den Herd. Salbei und Tymian gegen den Geruch des Unheils. Manche glaubten, daß der Rauch des Gasthauses nie ganz verschwunden sei. Alte Reisende erzählten, sie hätten ihn gesehen, einen dünnen, fast blauen Streifen, der sich an windstillen Abenden über die Heide legte.
Sie sagten: “Es rieche nicht nach Feuer, sondern nach Gewürz.” In den Kirchen predigten Pfarrer über die Versuchung des Überflusses. “Ein volles Mal kann tödlicher sein als Hunger”, sagte einer in Winsen. In den Wirzhäusern sprach man leiser, wenn jemand Würste bestellte. Selbst in den großen Städten wie Hamburg oder Hannover begann man die Fleischereischaufenster mit Kreuzen aus Kreide zu markieren, als stünden sie unter göttlichem Schutz. Doch die Legende wandelte sich mit der Zeit.
Aus der realen Frau wurde eine Gestalt aus Geschichten, eine Mahnung und später ein Gespenst. Kinder glaubten, dass Anna Hartmann in Vollmondnächten Küchenheimsuche, um über die Reinheit des Essens zu wachen. Wenn ein Topf überkochte oder Fleisch verbrannte, sagte man, die Köchin rührt um.
Und immer, wenn Nebel über den Feldern lag, erinnerte man sich an das Gasthaus zum stillen Tal. Manche schworen, daß man, wenn man still lauschte, den Klang eines Messers hören konnte. Ein gleichmäßiges sorgfältiges Schneiden, das nie endete. So ging die Geschichte von Anna und Wilhelm Hartmann über in das, was die Leute Schattenkunde nannten.
Jene Erzählung, die zwischen Wahrheit und Warnung leben. Sie wurde zur Sage, zum Sprichwort, zum Fluch. In alten Chroniken findet man noch heute den Eintrag: Im Jahre des Herrn 187 endete das Gasthaus zum stillen Tal, doch sein Rauch blieb im Gedächtnis der Menschen.
Und in manchen Familien, wenn bei Festen der Braten aufgetragen wird, spricht man leise einen Spruch, den niemand laut zu erklären weiß, für die, die aßen, ohne zu wissen. Niemand weiß, ob es Gebet oder Warnung ist. Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts veränderte sich das Land. Die Dörfer, die einst vom Rhythmus der Jahreszeiten gelebt hatten, hörten nun das Pfeifen der Dampflokomotiven und das Klirren der Fabriken.
Doch während Maschinen und Elektrizität das Denken der Menschen erneuerten, blieb die Geschichte von Anna und Wilhelm Hartmann wie ein dunkler Schatten über Norddeutschland. In den Städten wuchs eine neue Generation auf, die die alten Geschehnisse nur noch aus Erzählungen kannte. Doch in den Gasthäusern, besonders entlang der alten Landstraße zwischen Hamburg und Köln, flüsterten sich die Menschen die Geschichte weiter.