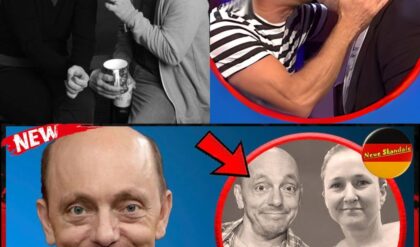Sie wurde Teil einer neuen Volksseele, nicht mehr nur Mahnung, sondern Spiegel des eigenen Zeitalters. Um das Jahr 1905 erschien in Berlin eine Sammlung düsterer Volkserzählung unter dem Titel Geschichten vom Rauch und Blut. Der Verfasser Georg Marlo ein Lehrer aus Hannover widmete ein ganzes Kapitel der Köchin aus dem Stillen Tal.
In seiner Fassung war Anna Hartmann keine Mörderin, sondern eine Frau, die vom Teufel selbst in Versuchung geführt wurde. In Nächten des Neumondes, so schrieb er, sei ihr ein Fremder mit schwarzem Mantel erschienen und habe ihr ein Messer geschenkt, das niemals stumpf wde.
Mit jedem Schnitt habe sie ein Stück Menschlichkeit verloren, bis sie schließlich selbst zur Kreatur des Rauches wurde. Das Buch verkaufte sich gut und bald erschienen Theaterstücke und Wandervorstellungen, in denen Schauspieler die Geschichte nachspielten. In Bremen zeigte eine reisende Truppe das Stück das Gasthaus zum stillen Tal, eine wahre Begebenheit. Zuschauer berichteten, dass während der Vorstellung ein seltsamer Duft durch den Saal gezogen sei.
Süßlich und schwer, als habe jemand etwas in den Kulissen geräuchert. Die Presse begann, den Fall wieder aufzugreifen. Zeitungen veröffentlichten Artikel mit Überschriften wie die erste deutsche Kannibalin oder die Mörderin, die kochte. Doch inmitten dieser Sensationslust fanden sich auch Stimmen, die tiefer blickten.
Ein Philosoph aus Leipzig, Professor Heinrich Wahlbaum, schrieb in einem Essay: “Die Geschichte der Hartmanns ist nicht nur ein Verbrechen, sie ist eine Parabel des modernen Menschen. Sie zeigt, wie leicht der Hunger nach Bedeutung in Hunger, nach Besitz und Fleisch übergeht.
” Er sprach von der Metapher des Geschmacks, einer Idee, dass die G nach Genuß, Wissen oder Macht denselben Ursprung habe. Jeder Mensch, schrieb er, trägt den Rauch des stillen Tales in sich, wenn er etwas begehrt, ohne zu fragen, was es kostet. Diese Worte fanden Anklang unter Intellektuellen, aber auf den Märkten blieb Anna Hartmann eine Spukgestalt. In manchen Gegenden zeigte man Kindern noch immer ihr Bild, um sie vom Stehlen oder Lügen abzuhalten.
“Wenn du naschst, kommt die Köchin und holt dich”, sagten Mütter, während sie Brot buken. Um das Jahr 1912 tauchten neue Legenden auf. Man erzählte, daß Arbeiter auf der Baustelle einer neuen Eisenbahnlinie in der Nähe des alten Gasthausgeländes auf Knochen gestoßen sein.
Manche behaupteten, sie seien menschlich gewesen. Ein Arbeiter schwor, er habe im Nebel eine Frauengestalt gesehen, die zwischen den Schienen gestanden und ihn angelächelt habe. Als er hinlief, war da nichts, nur der Geruch von Pfeffer. In dieser Zeit begannen auch die ersten Forscher sich systematisch mit Volksglauben zu befassen.
Der Ethnolog besuchte die Dörfer rund um das stille Tal und notierte über 30 Varianten der Hartmannlegende. In einer hieß Anna eine Kräuterfrau, die das Geheimnis ewigen Lebens im Rauch fand. In einer anderen war sie eine Heilige, die durch Menschenopfer Seelen von Sündern befreite. In der grausamsten Version aber hieß es: “Sie sei nie hingerichtet worden.
Der Henker habe sie verfehlt und sie lebe noch immer, verborgen in der Erde, wo sie das Fleisch der Toten räuchere.” Bötel schrieb in seinem Bericht: “Der Fall Hartmann hat sich vom Verbrechen zur Mythologie gewandelt. Sie ist nicht länger ein Mensch, sondern eine Figur des Deutschen Unbewussten, ein Sinnbild für die Furcht, dass Zivilisation nichts anderes ist als gutgewürzte Wildheit.
Während der ersten industriellen Welle begann sich der Geschmack der Deutschen tatsächlich zu verändern. Wurst und Fleisch verloren ihren früheren Stolz. Man sprach von Hygiene, von Reinheit, von Kontrolle. Metzgereien hängten Schilder mit der Aufschrift: “Nur Schwein, niemals Mensch aus.” Halb Scherz, halb Beschwichtigung. In den Wirzhäusern wurde der Name Hartmann zu einem Tabu.
Niemand bestellte eine Hartmannwurst, auch wenn das Rezept einer alten Familie so hieß. Ein Metzger in Hamburg, der zufällig denselben Nachnamen trug, änderte ihn offiziell, nachdem Kinder seine Ladenfenster mit Kreide beschmiert hatten. Hier kocht die Blutfrau. Doch in den dunklen Ecken des Volksglaubens blieb die Geschichte lebendig.