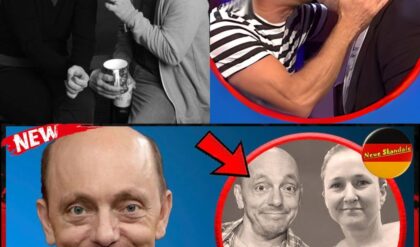Alte Erzähler sagten: “Wenn der Wind im Herbst durch die Heide ziehe und der Rauch der Räucher kann man sich über die Felder lege, soll man still bleiben und die Luft nicht einatmen. Denn mit jedem Atemzug könne man ein Stück von Anna Hartmanns Seele aufnehmen.” Und während das neue Jahrhundert voranschritt, blieb in den Herzen vieler das Wissen, dass selbst Fortschritt den alten Hunger nicht stillen konnte.
jenen Hunger nach Macht, Geschmack, Erkenntnis, der einst eine einfache Wirtin dazu gebracht hatte, das Heiligste zu durchbrechen, die Grenze zwischen Mensch und Mahlzeit. Im Jahr 1920 schrieb ein Journalist rückblickend: “Das Gasthaus zum Stillen Tal ist längst verfallen. Doch die Geschichte lebt, weil sie uns schmecken lässt, was wir am meisten fürchten, uns selbst.
Und irgendwo in der Heide, wo kein Haus mehr steht, roch man in jenem Sommer wieder Rauch. Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg waren von Hunger, Verzweiflung und einem Gefühl der Entwurzelung erfüllt. Städte lagen in Ruinen, Fabriken standen still und die Menschen kehrten mit leeren Händen und gebrochenem Blick aus den Schützengräben zurück.
In diesem Chaos, dass die Seele Deutschlands erschütterte, fand die alte Geschichte vom Gasthaus zum stillen Tal neuen Boden, um zu wachsen. Was einst eine blutige Sage war, wurde nun zu einer Allegorie über Schuld und überleben. Man erzählte sie in Küchen, in Baracken, in den Trümmern der Städte als Gleichnis über den Hunger, der den Menschen zu allem fähig macht.
Im Winter des Jahres 1919 kursierte in Hamburg ein Flugblatt mit dem Titel Die Frau, die den Hunger besiegte. Es war keine moralische Warnung, sondern fast ein Lob. Darin hieß es: “Als andere bettelten, wusste sie zu leben. Als die Welt hungerte, fand sie Nahrung. Ist das nicht Stärke? Ist das nicht der wahre Geist der Notzeit?” Die Behörden beschlagnahmten die Drucke, doch es war zu spät. Die Geschichte begann sich zu verändern.
Anna Hartmann wurde in den Erzählungen nicht länger als Monster dargestellt, sondern als Spiegel des Menschen, der tut, was getan werden muss. In Berlin, wo Hunger und Kälte den Alltag bestimmten, erzählte man sich eine andere Version. Anna sei gar nicht tot, sondern habe überlebt in einem alten Keller unter den Straßen.
Sie komme nur hervor, wenn der Mangel groß sei, um jenen zu helfen, die bereit sein, die Grenze zwischen Leben und Tod zu übertren. Man nannte sie die Mutter der Sättigung. Ein Schriftsteller namens Franz Bern, der in jenen Jahren für seine düsteren Expressionistentexte bekannt war, veröffentlichte im Jahr 1920 die Erzählung Der Rauch im Schnee. Darin begegnet ein ausgehungerter Soldat in einer zerstörten Stadt einer Frau, die ihm Suppe anbietet.
Er ist, fühlt sich gestärkt, doch am nächsten Morgen sieht er, dass die Suppenkeller aus einem menschlichen Schädel gefertigt ist. Die Frau lächelt und sagt: “Wer das Leben kosten will, muß das Leben essen.” Kritiker sahen darin eine Metapher für das zerbrochene Europa. Doch viele Leser erkannten sofort die Spuren der Hartmannsager, der Geschmack des Grauens, vermischt mit einer seltsamen Logik des Überlebens.
In den Jahren der Inflation, als das Geld jeden Wert verlor und die Menschen Brot gegen Schmuck tauschten, kehrte die Legende endgültig in den Alltag zurück. In Hannover erzählte man, daß eine Frau auf dem Markt Wurst verkaufe, die nach Erinnerung schmecke. Niemand wußte, was das bedeuten sollte, doch der Satz verbreitete sich.
Händler nannten verdächtige Produkte bald Hartmanns Fleisch, eine zynische Redewendung für etwas, dass man besser nicht hinterfragt. Ein Reporter der Zeitung Lüneburger Nachrichten schrieb 1923 In Zeiten, da das Volk verhungert, ist es gefährlich, alte Geister zu wecken. Die Köchin des stillen Tales wird nicht verschwinden, solange der Magen leer und das Herz voll Schuld ist. Auch in der Kunst tauchte ihr Name wieder auf.
Maler der neuen Sachlichkeit stellten sie in düsteren Bildern dar, nicht als Hexe, sondern als stämmige Frau mit Schürze und Messer, umgeben von Rauch, Brot und Körpern. Eines dieser Gemälde betitelt “Die Ernährerin” hing für kurze Zeit in einer Berliner Galerie, bevor es wegen unsittlicher Darstellung entfernt wurde.