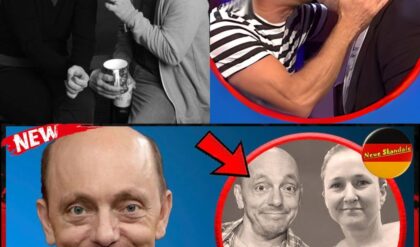Ein Lehrer aus Lübeck schrieb im Jahr 1954 in einem Schulaufsatz seiner Klasse: “Die Kinder kennen Märchen von Aschenputtel und Donn Röschen.” Doch eines erzählte mir eine Großmutter, die sagte, sie habe die Frau mit dem weißen Tuch gesehen, die Raucchaß. Das war der Beginn einer neuen Phase der Legende, ihrer Rückkehr in die Literatur, aber nicht mehr als blutige Gruselgeschichte, sondern als Symbol in Hamburg.
erschien 1956 eine wissenschaftliche Arbeit des jungen Psychologen Dr. Hans Keller betitelt Der Geschmack der Schuld. Keller untersuchte Volksmythen, die nach dem Krieg wiederkehrten und widmete der Hartmannsager ein ganzes Kapitel. Er schrieb: “Die Figur der Köchin verkörpert das verdrängte Bewusstsein eines Volkes, das sich selbst genährt hat, von Angst, gehorsam und Schuld.
Sie steht für das Mütterliche, das tötet, in dem es füttert. Keller wurde belächelt und zugleich bewundert. Seine These fand Anklang bei Philosophen, die in den 50er und sechziger Jahren begannen, die Moral der Nachkriegsgesellschaft zu hinterfragen. Bald erschienen Theaterstücke, Rundfunkhörspiele und erste Filme. Im Jahr 1957 sendete der norddeutsche Rundfunk ein Hörspiel mit dem Titel Rauch über der Heide. Es erzählte die Geschichte in modernen Bildern.
Eine Frau in einem verlassenen Dorf, die für Flüchtlinge kocht, während im Keller etwas Unaussprechliches geschieht. Die letzte Zeile lautete: “Und als sie den Rauch rochen, wussten sie, dass sie satt, aber nicht rein waren. Das Stück löste Empörung aus. Zeitungen nannten es blasphemisch, doch die Hörer schrieben hunderte von Briefen.
Viele sagten, sie hätten in der Stimme der Köchin etwas wiederkanntes gehört, etwas, das nicht tot war. In den 60er Jahren erreichte die Geschichte die Universitäten. Studenten lasen sie im Kontext von Psychoanalyse und kollektiver Erinnerung. Die französische Philosophin Elise Montan, die in Heidelberg lehrte, nannte sie in einem Vortrag die deutsche Medea.
Sie sagte: “In Anna Hartmann spiegelt sich das Land, das nährte und vernichtete, das liebte und verbrannte. Sie ist der Rauch, der bleibt, wenn die Geschichte gegessen ist.” Parallel dazu entstand in der Populärkultur eine neue Welle des Interesses. Im Jahr 1999 drehte der Regisseur Kurt Wallenstein den Film Das Gasthaus zum Stillental. Gedreht in schwarz-weiß mit gedämpftem Ton und langen Einstellungen von Nebel und Regen, erzählte der Film die Geschichte ohne Blut, aber voller Andeutung.
Anna wurde von der Schauspielerin Liselotte Hagen gespielt. still mit kalten Augen und zärtlicher Stimme. Der Film endete nicht mit ihrer Hinrichtung, sondern mit einer Szene, in der Rauch über die Felder zieht, während eine Stimme sagt: “Wir essen, was wir sind.” Der Film gewann einen Preis auf der Berlinale und löste zugleich Kontroversen aus.
Kirchenverbände protestierten, doch in Filmkreisen nannte man ihn den ersten deutschen Horror des Gewissens. In den 70er Jahren begann man den Fall als Symbol für das zu lesen, was man nicht sagen durfte. Die Verbrechen des Krieges, das Schweigen der Generationen, den Appetit auf Vergessen. Eine Professorin aus Götting, Ingrid Reuter, veröffentlichte 1973 das Buch Essen und Erinnerung, die Kultur der Schuld, indem sie schrieb: “Die Geschichte der Hartmanns zeigt, dass Schuld nicht vergeht, sondern sich verwandelt in Geschmack, in Geruch, in Kultur. Wir tragen sie mit uns wie ein Nachgeschmack, der nie vergeht.
Gleichzeitig wuchs die Faszination der Jugend mit dem Dunklen. In Studentenwohnung kursierten Gedichtsammlungen, die Anna Hartmann als Schutzheilige der Wahrheit bezeichneten. Bands nannten sich das stille Tal oder Rauchkind. Der Name wurde Mythos, Symbol, Rebellion.
Doch je moderner die Welt wurde, desto weniger sprach man vom eigentlichen Schrecken. Die Figur löste sich langsam vom realen Verbrechen. Aus der Mörderin wurde eine Schiffre für Weiblichkeit, Hunger, Macht, Erinnerung. In den 80er Jahren, als Deutschland sich in Wohlstand eingerichtet hatte, kam eine neue Generation von Forschern, die die Geschichte als kollektive Traumfigur betrachteten.