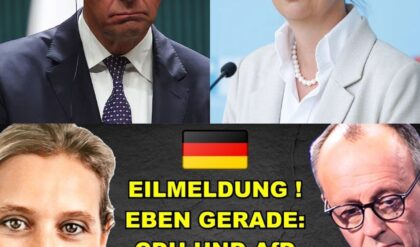Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass Christy durch acht Stichwunden gestorben war. Sie fanden außerdem Spuren eines sexuellen Übergriffs und sicherten biologisches Material des Täters.
Doch im Jahr 1985 steckte die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen und wurde in Ermittlungen kaum verwendet. Es gab keine Möglichkeit, das Material zu untersuchen, also wurde es für zukünftige Tests aufbewahrt.
Christys Mutter half der Polizei außerdem, ein weiteres Detail zu rekonstruieren: Christy hatte an diesem Tag einen Perlenring getragen – doch der Ring war verschwunden, weder am Körper noch am Tatort.
Die Ermittler schlossen daraus, dass der Mörder den Ring möglicherweise mitgenommen hatte, und wiesen alle Beamten an, die Pfandhäuser im Auge zu behalten, falls der Täter versuchen sollte, ihn zu verkaufen.
Da es keine physischen Beweise gab, konzentrierte sich die Polizei darauf, mögliche Zeugen zu finden, die Christy oder den Täter in der Nähe des Feldes gesehen haben könnten.
Sie fanden mehrere Personen, die den gleichen Pfad ungefähr zur Zeit des Mordes benutzt hatten, aber keiner von ihnen hatte etwas Verdächtiges bemerkt.
Es war merkwürdig – der Körper von Christy lag nur wenige Meter vom Weg entfernt, aber das hohe Gras machte es nahezu unmöglich, ihn zu sehen.
Die Ermittler erfuhren außerdem, dass nur wenige Dutzend Meter vom Fundort entfernt eine Familie an diesem Tag eine Grillparty im Garten veranstaltet hatte. Doch trotz der Nähe zum Tatort erinnerte sich niemand daran, etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen zu haben.
Ein Angestellter einer Tankstelle, etwa 60 Meter vom Feld entfernt, arbeitete ebenfalls den ganzen Tag, ohne etwas Auffälliges zu bemerken.
Für die Polizei war die Situation bizarr – so viele Menschen waren in der Nähe gewesen, und doch hatte niemand etwas gehört oder gesehen.
Die Ermittler vermuteten, dass der unbekannte Angreifer Christy entweder vom Laden bis zum Feld verfolgt oder sie zufällig auf dem Pfad getroffen hatte. Wahrscheinlich hatte er sie nur wenige Meter ins hohe Gras gelockt und dort getötet – ohne einen Laut.
Die Detektive erwogen die Möglichkeit, dass Christy ihren Mörder gekannt haben könnte, was erklären würde, warum keine Schreie zu hören waren. Schließlich war ihre Stadt klein, und viele Einwohner kannten einander.
Die Polizei begann, alle Männer zu überprüfen, die Christy gekannt hatten, doch diese Spur führte ins Leere.
Ebenso erstellten sie eine Liste von Männern in der Gegend, die bereits wegen Gewalttaten vorbestraft waren. Mehrere Verdächtige wurden überprüft, doch keiner konnte mit dem Mord in Verbindung gebracht werden.
Monatelang machte die Polizei kaum Fortschritte. Sie verfolgte Hinweise, befragte neue Verdächtige – doch jede Spur führte in eine Sackgasse.
Das zog sich drei lange Jahre hin, bis 1988 endlich ein unerwarteter Durchbruch kam.
Inzwischen war die DNA-Analyse zu einem wichtigen Instrument in der Kriminalistik geworden.
Die Ermittler beschlossen, DNA-Proben von allen zu nehmen, die im Laufe der Jahre als mögliche Verdächtige in Christys Fall in Betracht gezogen worden waren.
Viele erklärten sich bereit zur Kooperation – doch keine der Proben stimmte mit den biologischen Spuren vom Tatort überein.
Es gab jedoch eine Person, die sich weigerte, eine DNA-Probe abzugeben: Dana Henry, ein 34-jähriger Mann, der in der Nähe des Feldes lebte, auf dem Christy gefunden worden war.
Er war der Polizei schon in den ersten Tagen der Ermittlungen aufgefallen. Damals hatte Henry bestritten, irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben – doch seine Weigerung, nun eine Probe abzugeben, ließ die Ermittler ernsthaft an seiner Unschuld zweifeln.
Die Polizei beschloss, eine richterliche Anordnung zu beantragen, um seine DNA zu erhalten.
Henry erschien vor Gericht und beteuerte: „Ich bin unschuldig.“
Doch er wurde wegen Missachtung des Gerichts verurteilt und für mehrere Tage in eine örtliche Gefängniszelle gebracht.
Erst danach erklärte er sich bereit, eine DNA-Probe abzugeben.
Am Ende stimmte seine DNA nicht mit der des Täters überein – Henry wurde freigelassen.
Nachdem er wieder frei war, erzählte er den Reportern: „Ich wurde in einer Zelle ohne Kleidung festgehalten und erst entlassen, nachdem ich dem Druck nachgegeben und widerwillig zugestimmt hatte, eine Probe abzugeben.“
Henry sagte, er habe etwa 50.000 Dollar an Anwaltskosten bezahlt – eine erhebliche Summe zu jener Zeit.
Er musste sein Haus beleihen, das er schließlich verlor, und viele seiner Freunde und Familienmitglieder wandten sich von ihm ab.
Verärgert und verbittert reichte Henry eine Klage gegen die Polizei ein, doch sie brachte nichts.
Selbst nachdem die DNA-Beweise seine Unschuld bewiesen hatten, glaubten manche Leute immer noch, dass er schuldig war.
Jahre später gab Henry zu, dass die ganze Angelegenheit sein Leben ruiniert hatte – obwohl er nie offiziell eines Verbrechens beschuldigt worden war.
Ein Jahr später, 1989, kam es zu einer unerwarteten Wendung, die den Fall erneut ins Rampenlicht rückte.
Ein Richter erließ eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann aus der Stadt, der die Familie des Opfers mit Hinweisen überhäufte, wen er für Christys Mörder hielt.
Der Mann hieß Willis. Zum ersten Mal hatte er die Familie Wesselman Ende 1985 kontaktiert. Er behauptete, Informationen über die Identität des Täters zu haben, und begann, ihnen immer wieder neue Hinweise zu schicken.
Jeder einzelne Tipp wurde von der Polizei überprüft – doch jedes Mal stellte sich heraus, dass die Informationen entweder weit hergeholt oder völlig irrelevant waren.
Das ging fast vier Jahre lang so, bis Christys Familie es nicht mehr ertragen konnte. Schließlich reichte sie eine Beschwerde ein, und ein Richter ordnete an, dass Willis nie wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen dürfe.
Nach der einstweiligen Verfügung beschloss die Polizei, Willis selbst zu untersuchen – doch sie fanden keinerlei Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung brachten.
Im Jahr 2000 wurde die DNA des Mörders in die FBI-Datenbank hochgeladen, doch es gab keine Übereinstimmung.
Der Fall blieb kalt – viele Jahre lang.
Von Zeit zu Zeit nahm die Polizei die Akten wieder zur Hand, überprüfte alte Hinweise und ging neuen nach, doch sie kam nie dem Täter näher.
Das zog sich über drei Jahrzehnte hin.
Im Laufe der Jahre waren die ursprünglichen Ermittler entweder in den Ruhestand gegangen oder hatten die Abteilung verlassen, und Christys Fall wurde einem neuen Team übertragen.
Dann, im Jahr 2015, geschah etwas völlig Unerwartetes.
Eines Tages erhielt das Ermittlerteam eine Benachrichtigung aus der FBI-Datenbank:
Die DNA-Probe des Mörders von Christy passte perfekt zu einem kürzlich hochgeladenen Profil.
Die DNA gehörte einem 62-jährigen Mann namens Michael Jones, der in einer kleinen Stadt namens Champaign, etwa 240 Kilometer von Christys Heimatort entfernt, lebte.
Seine DNA war in die Datenbank aufgenommen worden, nachdem er wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden war.
Seine Ehefrau hatte ihn angezeigt, was zu seiner Festnahme geführt hatte.
Laut einem Gesetz, das 2002 im Bundesstaat Illinois verabschiedet worden war, musste jeder Verdächtige bei einer Verhaftung eine DNA-Probe abgeben.
Interessanterweise war der Hauptbefürworter dieses Gesetzes der Staatsanwalt desselben Bezirks, in dem Christys Mord geschehen war – und gerade dieser ungelöste Fall war einer der entscheidenden Gründe, warum er sich so stark für das Gesetz eingesetzt hatte.
Sobald die Übereinstimmung bestätigt war, begannen die Ermittler, Michael Jones genauer unter die Lupe zu nehmen.