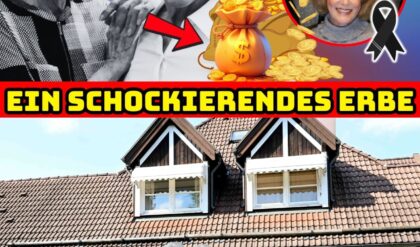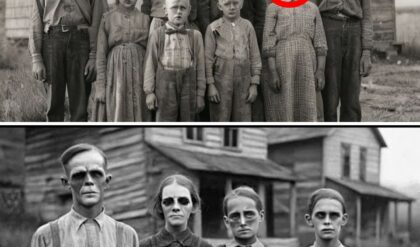Sie nannten es den Fall Kern und diskutierten, ob die Brüder von Wahnsinn oder Ideologie getrieben waren. Ein Professor aus Heidelberg schrieb: “Das wahre Grauen dieses Falles liegt nicht in der Brutalität, sondern in der Ordnung, mit der sie begangen wurde. Die Vernunft ohne Gewissen ist das Werkzeug des Teufels.” Doch die Behörden dachten praktischer.
Sie richteten ein eigenes Büro für vermisste Frauen ein, das in München arbeitete und Berichte aus ganz Süddeutschland sammelte. Jedes Gesuch wurde geprüft, jede Anzeige auf verdächtige Ähnlichkeit untersucht. Luzinde Gerhard wurde mehrfach dorthin eingeladen, um Vorträge zu halten. Sie sprach leise, sachlich, aber eindringlich über die Gefahr, den falschen Versprechung zu trauen.
Ihre Geschichte wurde in Schulen erzählt, in Kirchengemeinden, sogar in den Fabriken, wo Mädchen aus armen Familien arbeiteten. Sie warnte, das Böse trägt oft eine Brille und ein Lächeln. In jenen Jahren veränderte sich die Gesellschaft leise.
Frauen durften sich zum ersten Mal bei bestimmten Behörden selbst registrieren lassen, um ihre Reisen offiziell zu melden. Zeitungen führten Kennzeichen für geprüfte Anzeigen ein und in manchen Kirchen begannen die Pfarrer vor dem Altar für vermisste Frauen zu beten, so wie man sonst für Soldaten betete. Im Sommer des Jahres 1886 wurde in Sondofen eine Gedenkfeier abgehalten.
Kommissar Borg, mittlerweile grau und müde, hielt eine Rede, die in den Zeitungen abgedruckt wurde. Ich habe mehr gesehen, als ein Mensch sehen sollte und mehr gehört, als ein Herz tragen kann. Doch wenn eines bleibt, dann dies. Wer die Wahrheit aufschreibt, rettet sie vor dem Vergessen. Das Buch, das die Schuld beweist, ist auch das Buch, das die Unschuld verteidigt. Nach der Feier ging er hinunter zur Rappenalpschlucht, wo die Erde nun wieder vom Gras bedeckt war.
Er kniete sich hin und legte eine Hand auf den Boden. “Ru in Frieden”, flüsterte er. Wenige Monate später verließ er den Dienst. Er zog nach Augsburg, wo er im Alter von 68 Jahren starb. Auf seinem Grabstein steht: “E schrieb, damit andere leben.” In den folgenden Jahrzehnten verwandelte sich der Fall Kern in ein Symbol.
Dichter schrieben Gedichte über das Böse hinter der Fassade. Maler malten Bilder mit dem Titel “Die Scheune im Nebel”. Historiker sahen darin den Beginn der modernen Kriminalistik, weil Burgsmethoden, vermissten Listen, Tatortfotografie, forensische Dokumentation erstmals systematisch angewandt worden waren.
In den Archiven des Bayerischen Innenministeriums blieben die Akten aufbewahrt, zusammen mit dem Lederbuch, sorgfältig verschlossen in einer Truhe mit der Inschrift, nur für Forschung. In Leipzig veröffentlichte Luzinde im Jahr eine erweiterte Ausgabe ihrer Erinnerungen. Darin beschrieb sie nicht nur ihr Leid, sondern auch die Prozesse, die ihr Leben danach geprägt hatten.
Die ständigen Albträume, das Misstrauen gegen fremde Männer, aber auch den langsamen Sieg der Hoffnung. Ich habe gelernt”, schrieb sie, “dass man das Böse nicht vergisßt, aber man kann lernen, es zu überleben.” Das Buch wurde in mehreren Auflagen gedruckt, fand Leser in ganz Europa. Selbst in Wien und Zürich las man von der Frau, die dem Tod entkam.
Als Luzinde im hohen Alter starb, erschien ein Nachruf im Tagblatt. Sie hat das Grauen in Mut verwandelt. Ihr Grab befindet sich auf dem Südfriedhof in Leipzig. Auf dem Stein stehen nur die Worte: Luzinde Maria Gerhard. Sie überlebte und sprach. In Bayern blieb die Geschichte lebendig. Jedes Jahr legten Frauen aus dem Umland Blumen am Denkmal nieder.
Kinder lernten in der Schule, was dort geschehen war. Und alte Leute sagten: “Wenn der Nebel im Herbst besonders dicht wurde, das ist der Atem derer, die nie heimkam. Manchmal, so erzählten Wanderer, höre man in der Stille der Berge das ferne klirren von Ketten oder vielleicht nur den Wind, der sich an den Felsen bricht, aber wer es einmal gehört hatte, vergaß es nie. Im frühen 20.
Jahrhundert begann man das Geschehen, um die Brüder Kern wissenschaftlich zu untersuchen. Junge Juristen und Mediziner reisten in die Archive von München, um die alten Akten zu lesen. Unter ihnen war auch ein gewisser Dr. Karl Farber, Dozent für Kriminalrecht an der Universität Würzburg. Er schrieb in seiner Abhandlung von 1905 der Fallkern bleibt der Wendepunkt, an dem die Untersuchung des Verbrechens von der Moral zur Methode überging.