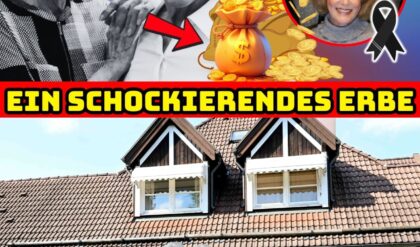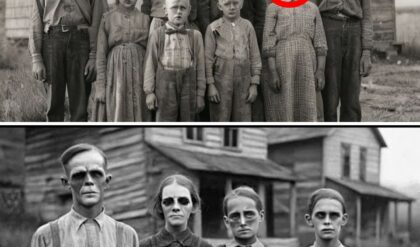Joa zum ersten Mal wurde das Grauen nicht nur gefühlt, sondern gemessen, protokolliert, bewiesen. Er sprach vom Beginn der modernen Beweissicherung und nannte Burgs Protokolle die Geburt der forensischen Vernunft. Doch hinter all diesen nüchternen Begriffen lag immer noch die menschliche Tragödie.
Zeitzeugen, die als Kinder die Hinrichtung gesehen hatten, erzählten in ihren alten Tagen, wie die Menge gebetet und doch nicht weggesehen hatte. Ein alter Schmied erinnerte sich. Als der Strick sich spannte, war es, als würde der Himmel stillhen. In Sondhofen wuchs das Denkmal zum Pilgerort.
Frauen aus ganz Süddeutschland kamen, manche mit Briefen in den Händen, die sie nie abgeschickt hatten, andere nur mit Tränen. Die Pfarrer hielten am Jahrestag eine Messe, in der sie jedes Mal die Namen der 42 Opfer verlasen. Jahr für Jahr halte die Litternei über den Friedhof. Sarah Wittmann, Anna Reinhard, Margarete Fink und jedes Jahr schien der Wind leiser zu werden, als lausche er.
Doch die Zeit ging weiter und mit ihr die Erinnerung. Als der erste Weltkrieg begann, rückten andere Schrecken in den Vordergrund. Männer starben zu Millionen und die Geschichte der Zuchtscheune wurde in den Zeitungen kaum noch erwähnt. Nur Lucindes Buch blieb in einigen Familien erhalten, weitergegeben wie eine Mahnung.
Nach dem Krieg in den 20er Jahren, als Bayern sich veränderte, erinnerte sich ein Journalist der Süddeutschen Nachrichten an die Akten im Archiv. Er fuhr nach München, las tagelang in den vergilbten Seiten und schrieb eine Artikelserie unter dem Titel Das Tagebuch des Teufels. Sie erschien in fünf Teilen und löste erneut Bestürzung aus.
Leser schrieben empört, fragten, wie solche Männer Priester vertraut, Nachbarn geduldet haben konnten. Die Justiz antwortete, indem sie die Akten erneut prüfte, um sicherzugehen, dass keine weiteren Mittäter übersehen worden waren. Man fand keine neuen Schuldigen, doch man erkannte, wie sehr Gleichgültigkeit das Verbrechen ermöglicht hatte.
Ein Richter schrieb am Rand der alten Dokumente: “Das Schweigen der vielen ist die Rüstung des Bösen.” Diese Worte wurden später oft zitiert. In den 30er Jahren, als Deutschland wieder dunkler wurde, verschwanden viele Exemplare von Lucindes Buch aus den Bibliotheken. Es passte nicht mehr in die Zeit, in der man von Reinheit und Blut sprach.
Doch manche Frauen versteckten die Hefte in Truhen zwischen Bibeln und Familienbriefen. Nach dem Krieg, als die Städte in Trümmern lagen, fanden Historiker sie wieder. Eine Professorin aus Tübingen, die sich mit Frauenverfolgung befasste, schrieb im Jahr 1949: “Luzindes Zeugnis ist nicht nur ein Bericht über ein Verbrechen, sondern eine Warnung an jedes Zeitalter, dass das Wort Reinheit über das Wort Menschlichkeit stellt.” In dieser Zeit begann man auch, das Denkmal in Sondhofen zu restaurieren.
Der Stein war verwittert, die Inschriften kaum lesbar. Schülerinnen aus der Gegend putzten ihn mit Bürsten, trugen neue Buchstaben auf, erneuerten den Eisenschmuck. Im Jahr 1950 weite der Bürgermeister das Mahnmal neu ein. In seiner Rede sagte er: “Es gibt Orte, die niemals vergessen werden dürfen, weil sie zeigen, wohin der Mensch gelangt, wenn er Gott für sich beansprucht.
” Während der Nachkriegsjahre nahm die Geschichte von Luzinde und den Brüdern Kern wieder ihren Platz in den Schulbüchern ein. Lehrer erzählten davon, um die Kinder zu lehren, dass Gehorsam kein Schutz vor Schuld ist. Viele von ihnen fuhren mit ihren Klassen zum Denkmal, um Blumen niederzulegen. Es war ein stiller Ort, aber voller Bedeutung.
In den sech Jahren kam ein Filmregisseur aus München auf die Idee, die Geschichte zu verfilmen. Der Film hieß Der Hof im Nebel. Er zeigte das Geschehen in Schwarz-weiß, ohne Blut, ohne Schreie, aber mit der Kälte des Schweigens. Er gewann Preise, wurde in keinen gezeigt und brachte das Thema in die Weltöffentlichkeit. Zum ersten Mal hörten auch Menschen in anderen Ländern von der Zuchtscheune im Algu.
Lucindes Geschichte wurde zu einem Symbol für weibliche Stärke und Überleben. Man verglich sie mit Jean Dark, mit Anne Frank, mit all den Frauen, die durch ihr Zeugnis das Unrecht sichtbar machten. Und während die Welt sich weiterdrehte, blieb der Stein in Sondhofen stehen.