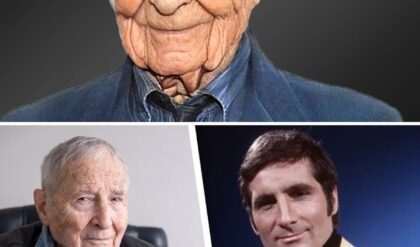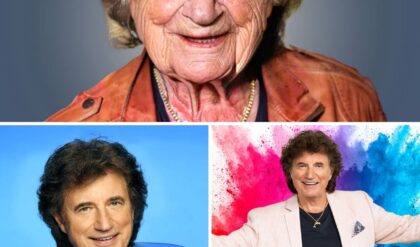Dabei verteidigt Nuhr sogar Merz’ Recht, „einen rauszuhauen“. Wenn das Volk einen Politiker wünsche, der nicht „so gelackt“ sei und auch einmal unpräzise sei, müsse man dies eben hinnehmen. Doch das Problem liegt tiefer: Es ist nicht die Abwesenheit von Präzision, sondern die Abwesenheit von Prioritäten. Solange Merz nicht überzeugend zeigt, dass er die wirtschaftliche Notlage und die Bildungsmisere als zentrale Herausforderungen begreift, bleibt der Eindruck eines Politikers, der zwar Energie investiert, aber ziellos im Tagesgeschäft mitschwimmt.
Teil II: Die Krise der Diplomatie – “Unfassbare Dummheit” im Auswärtigen Amt
Ein weiterer Kernbereich von Nuhrs Abrechnung ist die deutsche Außenpolitik, deren Zustand er mit dem scharfen Wort „Diplomatie“ beschreibt – oder vielmehr deren Fehlen. Im Fokus steht hier die (implizite) Kritik an der Amtsführung der aktuellen oder früheren Außenminister, namentlich Annalena Baerbock und deren Nachfolger Herrn Wadephul.
Nuhrs Schilderung des außenpolitischen Agierens wirkt wie ein Lehrstück in diplomatischer Selbstsabotage. Er erinnert an den Fauxpas, China von Japan aus zu kritisieren – ein Akt, der Nuhr als „besonders unsensibel“ erscheint, da Japan sich für die mehrfachen Überfälle auf China bis heute nicht entschuldigt habe. Die logische Folge: Termine in China werden abgesagt. Nuhrs vernichtendes Urteil: „eine unfassbare Dummheit, wie ich meine, die ich mir nicht erklären kann“.
Das eigentliche Rätsel, das Nuhr umtreibt, ist die Besetzung dieses wichtigsten Postens im Auswärtigen Amt. Er fragt sich, wieso das Amt immer wieder mit Leuten besetzt wird, die „offenbar keinen Fettnapf auslassen“. Gerade in einer Zeit, in der Deutschland sich in einer „sehr prekären Situation“ befindet – eingekeilt zwischen den eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China, unserem wichtigsten Außenhandelspartner – sei es existenziell notwendig, mit beiden Großmächten zu reden und sich nicht vorzeitig für einen Partner zu entscheiden.
Nuhr betont ein altes, universelles Prinzip der Diplomatie, das er in der aktuellen Regierung vermisst: Reden. Seine eigene Erfahrung mit Chinesen illustriert er anschaulich: Man kann den Chinesen alles sagen, aber erst wird eine Stunde lang gegessen, über das Wetter geredet, und danach ist alles sagbar. Dies ist die Kunst der Gesprächsführung, des respektvollen Brückenbauens, die im politischen Berlin offenbar vergessen wurde. Stattdessen erlebt man nur die Abwesenheit des zentralen Wortes: „Diplomatie“. Deutschland agiert, Nuhr zufolge, in einer globalen Arena, in der Takt und Fingerspitzengefühl über Wohl und Wehe der eigenen Wirtschaft entscheiden, mit einer erschreckenden Mischung aus moralischer Überheblichkeit und strategischer Naivität.
Teil III: Die ökonomische Selbstgeißelung und die verschwendete Motivation
Die Diskussion über die deutsche Wirtschaftspolitik führt Nuhr zur Kernfrage der Arbeitsmotivation und der staatlichen Belohnung von Leistung. Er stellt fest, dass in Deutschland die Arbeitseinstellung sich verändert habe und führt dies auf die „Arbeitsbelohnung“ zurück.
Seine Rechnung ist brutal einfach und zugleich ernüchternd: Wenn man mit zwei Kindern 3000 € verdient und durch Vollzeitarbeit auf 5000 € kommt, man aber effektiv nur 100 € mehr „rausbekommt“, ist die Motivation, mehr zu arbeiten, quasi nicht existent. Dieses steuerliche und abgabenrechtliche System wirkt wie eine Strafsteuer auf zusätzliche Leistung. Es entmutigt die Bürger, sich über das Nötigste hinaus anzustrengen, und wirkt damit direkt der Notwendigkeit entgegen, die Produktivität zu steigern. Deutschland belohnt Inaktivität und bestraft Mehrarbeit – ein Rezept für ökonomische Stagnation.
Diese Fehlsteuerung wird durch das Bild der staatlichen Verschwendungssucht ergänzt, deren trauriger Höhepunkt die „600.000 Euro für eine Toilette in Stuttgart“ darstellt. Solche Ausgaben sind mehr als nur anekdotische Belege für Unvernunft; sie sind ein Symbol für die Gleichgültigkeit, mit der die Politik mit den hart erarbeiteten Steuergeldern umgeht.