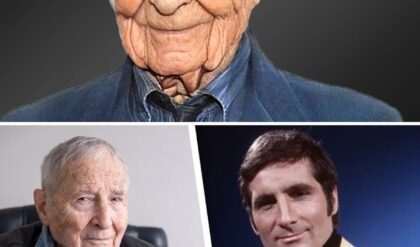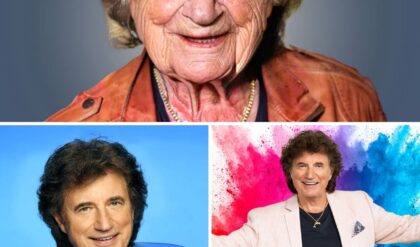Das Resultat dieser politischen Verfehlungen ist laut Nuhr unübersehbar: Investoren verlassen das Land scharenweise. Die hohe Komplexität, die steigenden Lohnkosten (die nicht mehr durch höhere Produktivität aufgefangen werden können) und die unsichere politische Strategie haben zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Das Land befindet sich in einer Abwärtsspirale, doch die Politik konzentriert sich auf die falschen Debatten – auf symbolische Stadtbild-Diskussionen statt auf die Frage, wie die Produktivität und die Investitionsbereitschaft zurückgewonnen werden können.
Teil IV: Die verlorene Generation – 40 Jahre gescheiterte Bildungsreform
Als einen der „ganz wesentlichen Probleme“ in unserem Land identifiziert Nuhr das Bildungssystem, das er als das Ergebnis von „40 Jahre progressive Reformpolitik“ beschreibt, die „ins Nichts geführt“ habe.
Nuhr, der sich selbst als Teil der ersten Generation der „aufgelösten Klassenverbände“ und als jemand bezeichnet, der durch die „grüne Alternative linken Eck“ der 70er Jahre gegangen und später „klüger geworden“ ist, urteilt vernichtend über die Folgen dieser ständigen Reformen: „Nie ist es besser geworden“. Das System bringt Absolventen hervor, die „die Universitätsanforderungen nicht so richtig erfüllen“ und denen mit Lesen und Schreiben nachgeholfen werden muss.
Die Krise der Bildung ist für Nuhr unmittelbar mit der Krise der sozialen Durchlässigkeit verbunden. Er räumt offen ein, dass er sich das Bildungsengagement für seine eigene Tochter leisten konnte, indem er viel Wert auf Bildung legte, viel reiste und ein anregendes privates Umfeld schuf. Doch dies sind „Privilegien“. Diese private Kompensation des staatlichen Versagens führt dazu, dass die soziale Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft „nicht mehr so ist, wie sie mal war in der Nachkriegszeit“. Gebildete Eltern können ihre Kinder anders fördern und die Lücken des staatlichen Systems schließen – ein schwer zu durchbrechender Kreislauf der Ungleichheit, der die Chancengerechtigkeit in Deutschland massiv untergräbt.
Die politische Herausforderung, die er sieht, besteht nicht in einem Mangel an Ideen – er selbst schlägt kleine Maßnahmen vor, wie mehr Bildung in die Schule zu verlagern, statt Hausaufgaben zu geben –, sondern in der Tatsache, dass die Politik 40 Jahre lang eine Ideologie verfolgt hat, deren empirische Ergebnisse ein Desaster sind.
Fazit: Die Abwesenheit des Wesentlichen
Dieter Nuhrs Abrechnung ist weit mehr als nur ein satirischer Angriff auf einzelne Politiker. Es ist die Anklage einer politischen Klasse, die den Kontakt zur Realität der großen nationalen Herausforderungen verloren hat. Von der „Augsburger Puppenkiste“ bis zum „Fettnapf“ der Außenpolitik, von der „unfassbaren Dummheit“ der Diplomatie bis zur „Strafsteuer“ auf Mehrarbeit: Das zentrale Thema ist die Abwesenheit.
- Die Abwesenheit einer klaren Vision bei der Opposition (Merz).
- Die Abwesenheit von Diplomatie im Auswärtigen Amt.
- Die Abwesenheit von Fokus auf die existenziellen Probleme (Wirtschaft, Bildung).
Die Szene, in der Maischberger kreidebleich wurde, ist symbolisch für den Moment, in dem die bequeme Illusion des politischen Tagesgeschäfts der schmerzhaften Wahrheit weichen musste. Deutschland diskutiert über das Stadtbild, während Investoren das Land verlassen. Es reformiert Bildungssysteme ins Nichts, während der internationale Handel auf Messers Schneide balanciert.
Die Frage, die am Ende von Nuhrs genialer Analyse bleibt, ist die dringlichste überhaupt: Wie lange kann ein Industrieland es sich leisten, die Prioritäten derart falsch zu setzen? Die Zeit drängt. Das Land benötigt dringend eine politische Führung, die bereit ist, über die Floskeln und die Nebensätze hinauszugehen, die Fehler der progressiven Reformen einzugestehen und sich auf die Wiederherstellung der Produktivität, der Bildung und der strategischen Diplomatie zu konzentrieren. Andernfalls wird Nuhr in drei Jahren nicht nur Merz, sondern das gesamte Land als einen Ort beschreiben, der „gerade erst angefangen“ hat – mit dem endgültigen Niedergang.