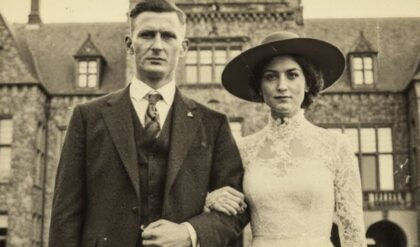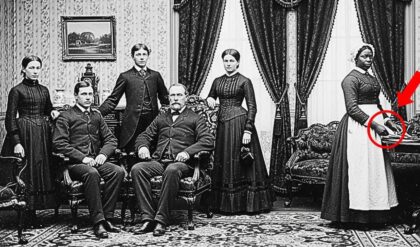„Wann war ein Gegenstand wirklich zum ersten Mal da?“
Dieser Satz löste eine tektonische Verschiebung in der öffentlichen Wahrnehmung aus. Die Erkenntnis verdichtete sich: Der Stoffrest, der angeblich „verbrannt und verwittert“ war, wies Brandmuster auf, die laut einem anonymen Forensiker darauf hindeuteten, dass das Material „deutlich später in die Natur gelangt sei“. Wenn ein Gegenstand nicht dort war, als er gesucht wurde, aber dort war, als man später zurückkehrte, musste sich etwas in der Zwischenzeit verändert haben.
Das Dilemma ist damit offenkundig:
-
Fundort-Manipulation: Hat jemand den Fundort manipuliert, um eine bestimmte Spur zu legen oder eine Theorie glaubwürdig erscheinen zu lassen?
-
Falsche Interpretation: Passte der Zustand der gefundenen Reste (etwa die Verwitterung oder die Brandmuster) nicht zu der Zeitspanne, in der sie angeblich dort gelegen hatten?
Wie ein Journalist es auf den Punkt brachte: „Es ist nicht die Frage, warum der Gegenstand dort lag, sondern warum erst jetzt dort lag.“ Petermanns Schweigen nach diesen Berichten war in Ermittlerkreisen das Beunruhigendste, denn „Petermann schweigt nur dann, wenn er etwas prüft, das schwer wiegt“.
Der kollabierende Tatort: Angst und Hoffnung in der Gemeinde
Die Auswirkungen von Petermanns Analyse waren sofort in Güstrow spürbar. Anwohner, deren Aussagen zuvor als „nicht belastbar“ galten – wie die einer Frau, die behauptete, in der fraglichen Nacht „ungewohnte Lichter im Wald“ gesehen zu haben –, bekamen plötzlich ein neues Gewicht. Ihre vagen Zeitangaben kollidierten auf erschreckende Weise mit der Frage nach der manipulierten Zeitlinie.
Die Vermutung, die in den sozialen Medien und unter Kriminologen immer lauter wurde, war die wohl schockierendste Konsequenz der Zeitlinien-Frage: „Wenn die Zeitlinie nicht stimmt, dann stimmt möglicherweise auch der angenommene Tatort nicht.“
Dies wirkte wie ein Hammer. Denn wenn der Fundort lediglich ein Ablageort war, hätte sich die gesamte Ermittlung von Anfang an auf den falschen Fokus gestützt. Das Gefühl in Güstrow war ein Wechselbad der Gefühle:
-
Erleichterung bei der Familie: Die Angehörigen fühlten sich erstmals nicht mehr „völlig im Dunkeln“ und sahen, dass jemand „Fragen stellte, die bisher niemand laut ausgesprochen hatte“.
-
Angespanntheit bei der Polizei: Beamte, die von ihrer korrekten Arbeit überzeugt waren, fürchteten, dass nun „mögliche kleine Fehler einem Brennglas betrachtet würden“.
-
Wachsende Angst in der Nachbarschaft: In der Kleinstadt, in der man sich kennt, herrscht ein Gefühl der Unsicherheit. Jeder befürchtet, ungewollt Teil eines Puzzles zu sein, das niemand vollständig versteht.
Petermanns Präsenz hat den Fall neu belebt und ihn in eine neue Tiefe geführt, in der „Zeit im Verbrechen oft das ehrlichste Element“ ist. Sein Fokus auf das Wann und die späten Funde lässt viele glauben, dass die Wahrheit an die Oberfläche drängen wird – auch wenn sie unbequem sein könnte. Die Geschichte, die man bisher zu kennen glaubte, ist möglicherweise nur ein Fragment einer viel größeren Wahrheit.
Der Fall Fabian ist noch lange nicht abgeschlossen. Vielleicht, so die dunkle Ahnung in ganz Deutschland, beginnt er erst jetzt wirklich.