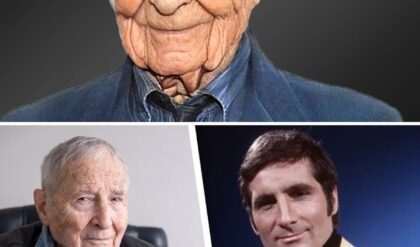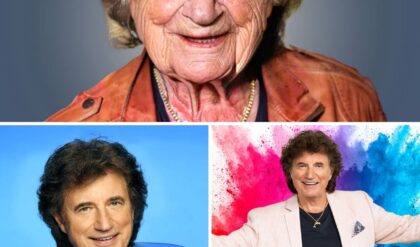Brockhaus argumentiert, dass die Notwendigkeit, durchzuhalten, auch gegen den Einwand, die Bundespolizei sei an anderen Orten dringender gebraucht, gelte. Sie berief sich auf Stimmen innerhalb der Polizei, die bestätigten, die Grenzkontrollen seien durchhaltbar.
III. Der Merkel-Präzedenzfall: Die Legitimität der Ausnahme
Ihr stärkstes Argument in der politischen Verteidigung der Unionspolitik ist der Präzedenzfall von 2015.
„Angela Merkel hat 2015 Dublin, worüber wir heute debattieren, außer Kraft gesetzt. Rechtlich war das in Ordnung. Das ist ganz wichtig, weil es gibt immer diesen Mythos. Angela Merkel hätte das Recht gebrochen, hat sie nicht gebrochen.“
Indem sie die rechtliche Legitimität von Merkels Aussetzung der Dublin-Regeln betonte, schuf Brockhaus einen entscheidenden Hebel: Dublin wurde also schon einmal außer Kraft gesetzt. Folglich sei es scheinheilig, wenn man heute von „Populismus“ spreche, nur weil die Union macht, „was die Bürger wollen und was übrigens auch schon mal getan wurde, nur halt in anderer Hinsicht“.
Für Brockhaus ist das Vorgehen selbst dann richtig, wenn es „nur Symbolpolitik ist“. Symbolpolitik sei richtig, weil sie nach außen zeige, dass der Staat Grenzen habe und diese schütze. Es sei eine Aufgabe des Staates, nach außen zu zeigen, dass man nicht alle aufnehmen könne. Wenn der europäische Zusammenhalt daran scheitere, dass Deutschland seine Grenzen schütze, dann sei der europäische Zusammenhalt in seiner jetzigen Form ohnehin gescheitert.
Hier wird die Debatte zur Grundsatzfrage: Wie viel nationale Souveränität ist Deutschland bereit aufzugeben, um den europäischen Konsens zu wahren? Brockhaus’ Antwort ist unmissverständlich: Deutschland muss sich selber schützen.

IV. Die Grenzen der Kapazität und die gescheiterte Integration
Die Diskussion verlagerte sich schnell von der Rechts- und Sicherheitspolitik zur Frage der Integrationsfähigkeit und Aufnahmekapazität Deutschlands. Brockhaus, die sich als große Europäerin und Kennerin des Europarechts darstellte, stellte die humanitäre Dimension der Debatte auf den Kopf:
„Wir können doch auch nicht alle aufnehmen und dann sind wir auch nicht humanitär. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Man kann nicht alle nehmen und sie richtig integrieren.“
Sie nutzte die eindringliche Metapher des überfüllten Hauses: „In ein Haus mit sechs Zimmern passen auch nicht 300 Menschen.“. Die Kritiker, die Deutschland als ein Land mit zehn Zimmern darstellen, in dem nur drei bewohnt sind, ignorierten die Lebensrealität. Die Wahrheit sei, dass Deutschland seiner humanitären Verantwortung nicht gerecht werde, wenn es immer mehr Menschen aufnehme, ohne sie richtig integrieren zu können.
Die Probleme der Integration lägen dabei auch an Deutschland selbst, an den Ämtern und der Bürokratie. Anstatt immer mehr aufzunehmen, müsse sich die Politik auf die Integration der Menschen konzentrieren, die bereits hier sind. Sie forderte eine Zuwanderung, die arbeitet, und untermauerte dies mit persönlichen Anekdoten aus dem Alltag.
In diesem Kontext kritisierte sie die Turbo-Einbürgerung als „Verschleudern der deutschen Staatsbürgerschaft“, während Schröder diese gerade als „gute Idee“ für qualifizierte Leute lobte. Die tiefe Kluft zwischen den Lagern wird hier sichtbar: Die einen wollen schnell qualifizierte Arbeitskräfte binden, die anderen sehen in der Staatsbürgerschaft ein Gut, das nicht leichtfertig vergeben werden darf.
V. Die Entartung der Debattenkultur: „Populismus“ als Notausgang
Der eigentliche Skandal dieser Talkshow – und das wichtigste Argument der Analyse – liegt im Zustand der demokratischen Debattenkultur.
Am Ende der Diskussion, als die Argumente zur Neige gingen, wurde die Kritik an Brockhaus zunehmend persönlich und reflexhaft. Die Unterstellung, ihre Meinung sei nur getrieben durch finanzielle Interessen ihres Unternehmerehemanns, war ein Tiefpunkt, der jegliche inhaltliche Auseinandersetzung verließ.
Der Sprecher des Videos und die Analyse kommen zum gleichen Schluss: Es ist ein alarmierendes Zeichen, wenn Kritik reflexhaft als Populismus abgestempelt wird. Dieses Wort, einst ein wichtiges analytisches Instrument, verkomme zunehmend zu einem bequemen Totschlagargument.
„Wer Fragen stellt, wer Zweifel äußert, wer Entscheidungen der Regierung hinterfragt, wird mit einem Schlag diskreditiert, bevor seine Argumente überhaupt gehört wurden.“
In diesem Moment endet die Diskussion, nicht weil die besseren Argumente gewonnen hätten, sondern weil die Gegner keine Argumente mehr besitzen. Sie ziehen den moralischen und intellektuellen „Notausgang“ des Populismus-Etiketts. Eine Gesellschaft, die Andersdenkende vorschnell in diese Schublade steckt, verliert die Fähigkeit zum Lernen, verengt ihren Blick und erstickt die Vielfalt, die eine Demokratie erst lebendig macht.