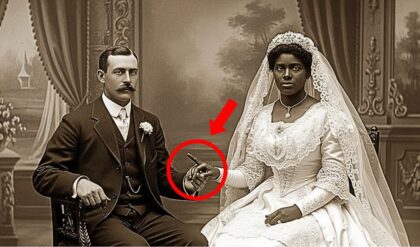-
Der Ermittlerfehler: Ein Polizist findet den Handschuh am ursprünglichen Ort (Ort A), dokumentiert ihn aber nicht korrekt oder legt ihn ab und vergisst ihn. Später wird er an Ort B gefunden und als neuer Fund gemeldet. Die lückenlose Dokumentation – Wo? Wann? Von wem? – ist nicht mehr gegeben. Vor Gericht wird der Beweis als nicht verwertbar eingestuft werden können.
-
Die zivile Kontamination: Ein Spaziergänger betritt das freigegebene Gelände, findet den Handschuh an Ort A, findet ihn merkwürdig, nimmt ihn mit und legt ihn aus irgendeinem Grund an Ort B wieder ab. Der Fundort B ist damit nicht mehr der ursprüngliche, was die gesamte Verwertbarkeit in Frage stellt.
-
Der Irrtum: Es handelt sich um zwei ähnliche, verkohlte Handschuhe, und der Zeuge verwechselt die Fundorte. Dies wäre die harmloseste Variante, muss aber zeitintensiv geprüft werden und zehrt weiter an den Ressourcen.
Unabhängig davon, welche dieser Möglichkeiten zutrifft: Die Verteidigung hat nun ein leichtes Spiel, die Glaubwürdigkeit dieses potenziellen Schlüsselbeweises zu erschüttern. Sollte DNA von Gina H. auf dem Handschuh gefunden werden, kann die Verteidigung argumentieren, dass sie als Reiterin oft Handschuhe trug und diesen vor Wochen an Ort A verloren haben könnte, bevor ein Dritter ihn bewegte – was nichts über ihre Beteiligung an der Tat aussagt. Zweifel säen ist der Job der Verteidigung. Und die Ermittler haben ihr mit diesem Fehler das perfekte Werkzeug an die Hand gegeben.
Das Verteidigungs-Arsenal: Wie die Anwälte die Fehler nutzen werden
Die Verteidigung von Gina H. muss nun keine eigenen Beweise für die Unschuld ihrer Mandantin vorlegen; sie muss lediglich die Beweislast der Staatsanwaltschaft als lückenhaft und unzuverlässig entlarven. Sie wird die Ermittlungsfehler zu ihrem zentralen Argument machen und damit die Unschuldsvermutung ins Zentrum rücken.
-
Angriffspunkt 1: Die verfälschte Fundstelle: Die Verteidigung wird argumentieren, dass aufgrund der Freigabe des Geländes nach 24 Stunden keine der wichtigen Spuren (Fußabdrücke, DNA, Fasern) zuverlässig als Täter-Spur eingestuft werden kann. Die Kontamination durch Dritte schafft einen unüberwindbaren „reasonable doubt“.
-
Angriffspunkt 2: Der Handschuh – Unglaubwürdiges Beweisstück: Der Handschuh wird als „unbrauchbarer Zufallsfund“ deklassiert werden. Die Aussage Novaks über eine „Panne“ ist ein öffentliches Schuldeingeständnis, das die Verteidigung genüsslich ausschlachten wird.
-
Angriffspunkt 3: Die fehlende Tatwaffe: Der härteste Schlag gegen die Anklage wird die Frage sein: „Womit soll meine Mandantin getötet haben?“ Ohne Tatwaffe können die Abläufe nur spekulativ rekonstruiert werden. Ohne Rekonstruktion wird es kaum möglich sein, die Schuld zweifelsfrei zu beweisen.
Für die Staatsanwaltschaft ist dies eine Herkulesaufgabe. Sie muss nun beweisen, dass die vorhandenen, fehlerfrei gesicherten Beweise (wie z.B. Handy-Daten, restliche DNA-Funde oder Zeugenaussagen) trotz der Pannen überwältigend genug sind, um jeden vernünftigen Zweifel auszuräumen.
Die Lehren aus dem Chaos: Was wir Fabian schuldig sind
Der Fall Fabian wirft ein Schlaglicht auf die strukturellen Probleme im deutschen Ermittlungssystem.
-
Ressourcenmangel: In ländlichen, unterbesetzten Polizeidienststellen führt der chronische Mangel an Personal und Kriminaltechnik dazu, dass in Fällen wie diesem Kompromisse eingegangen werden müssen. Ein Fundort wird zu früh freigegeben, weil die Manpower fehlt, ihn tagelang zu sichern.
-
Druck von außen: Der enorme öffentliche und mediale Druck bei einem Kindermord kann zu Hektik und vorschnellen Entscheidungen führen – eine psychologische Falle, in die die Ermittler offenbar getappt sind.
-
Transparenz vs. Taktik: Die Kritik der Familie an der Kommunikationspolitik der Behörden zeigt die Gratwanderung zwischen notwendiger Geheimhaltung (Täterwissen) und dem menschlichen Bedürfnis der Angehörigen nach Information.
Die Gerechtigkeit für Fabian darf nicht an fehlerhafter Ermittlungsarbeit scheitern. Wenn ein Schuldiger aufgrund von Pannen freikommt, ist das eine Tragödie für die Familie. Gleichzeitig ist es die Aufgabe des Rechtsstaates, jeden, auch den Tatverdächtigen, vor einer Verurteilung zu schützen, solange die Schuld nicht zweifelsfrei bewiesen ist.
Novaks ehrliche Offenlegung der Fehler ist ein wichtiger Schritt, aber er reicht nicht aus. Es braucht eine gründliche interne Aufarbeitung, um sicherzustellen, dass aus diesem Fall gelernt wird. Mehr Ressourcen, bessere Schulungen und klarere Protokolle für die Spurensicherung sind die politische Konsequenz, die aus diesem fatalen Fehlerkatalog gezogen werden muss.
Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Suche nach der Tatwaffe und dem eigentlichen Tatort geht weiter. Doch die nun eingeräumten Fehler haben die Ausgangslage massiv verschlechtert und werfen einen dunklen Schatten auf die Chance, Fabians Tod lückenlos aufzuklären und die Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.