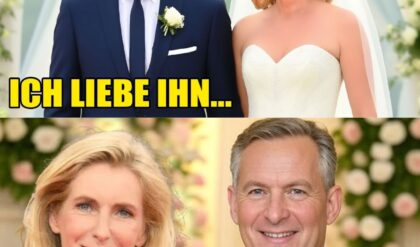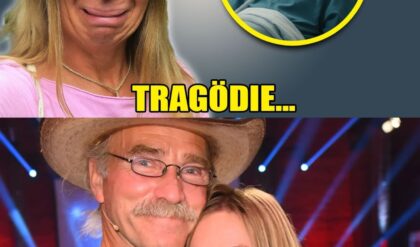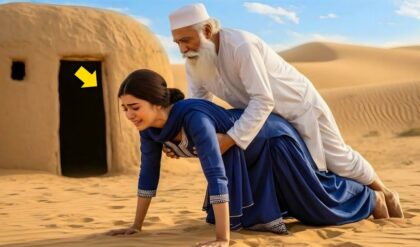Francine Jordi: Zwischen Volksmusik, Verletzlichkeit und neuer Freiheit
Eine Schweizer Ikone blickt zurück – und nach vorn. Kaum eine Künstlerin verkörpert die Seele der helvetischen Unterhaltung so geschlossen wie Francine Jordi: die klare Stimme, die elegante Bühnenpräsenz, die Verbindung von Tradition und Gegenwart. Doch hinter dem makellosen Bild liegt eine Biografie aus Disziplin, Brüchen und einem späten, beherzten Bekenntnis zur Liebe.
Ein früher Ruf auf die Bühne

Geboren 1977 in Großhöchstetten (BE), aufgewachsen in Richigen, zieht es die junge Francine schon mit neun Jahren in Morcote erstmals ins Rampenlicht. Was andere als Kinderspiel betrachten, wird für sie zum Lebensentwurf. Die Familie lebt Musik, nicht als Hobby, sondern als Haltung. Mit Schwester Nicole entsteht eine kleine Formation, Auftritte in Hotels und Ferienanlagen füttern Selbstvertrauen und Routine. Parallel baut sie am Konservatorium in Neuenburg die technische Basis: Gesang, Klavier, Stilgefühl.
Als sie den Künstlernamen „Jordi“ wählt – ein Berner Name, bodenständig, ungekünstelt – wirkt das wie ein Gegenentwurf zu globalen Kunstfiguren. Es ist eine bewusste Verankerung: Schweizerisch klingen, echt bleiben, heimathaltig. Der Durchbruch folgt 1998 beim Grand Prix der Volksmusik mit „Das Feuer der Sehnsucht“ – kein bloßer Chartmoment, sondern eine kulturelle Zäsur. Plötzlich steht wieder eine junge Schweizerin im internationalen Rampenlicht eines Genres, das lange männlich codiert war. Kompositorisch zwischen Volksmusik und Pop pendelnd, setzt sie auf Präzision statt Posen, auf Gefühl ohne Pathos.
Karriere ohne Klammerblätter
Jordi vermeidet Skandale, setzt auf Konstanz. In einer Branche der kurzen Halbwertszeiten bleibt sie eine verlässliche Größe: Balladen, Hymnen, Moderationen, Musik- und TV-Projekte – stets mit dem Versuch, Brücken zu schlagen: Alphorn und Pop, Heimatgefühl und Weltoffenheit. 2023 das 25-jährige Bühnenjubiläum, begleitet vom Agovia Philharmonic Orchestra in Aarau: mehr Manifest als Konzert, ein Familienbild auf der Bühne – Eltern Margret und Franz, die Schwestern Nicole und Tanja – und ein Repertoire, das die private Herkunft hörbar macht. Im selben Jahr erscheint ein Kochbuch mit Lieblingsfamilienrezepten; es wird ein Bestseller und zeigt die bodenständige, häusliche Seite der Künstlerin.
Im Januar folgt ein Titel, der Aufsehen erregt: „Schönste Schweizerin aller Zeiten“. Eine Auszeichnung, die – so die Begründungen – weniger auf Oberflächen als auf Ausstrahlung, Persönlichkeit und kulturellen Einfluss zielt. In einem Medienumfeld, das auf grelle Schlagzeilen programmiert ist, gilt Jordi als Gegenbild: Haltung statt Hast, Wärme statt Wucht.
Liebe und Lehre: Eine Biografie der leisen Töne
Privates bleibt lange privat, doch einige Kapitel sind unvermeidlich öffentlich. 2009 die Hochzeit mit Radstar Tony Rominger: schlicht, klassisch, kontrolliert – eine Feier der Vertrauenstöne. Zwei Jahre später die Trennung, nüchtern, würdevoll kommuniziert: getrennte Wege, großer Respekt. Kein öffentlicher Streit, kein nachgereichter Schmerz. Später wird sie sagen: Manche Beziehungen lehren uns, ohne ewig zu dauern. Disziplin und Gefühl – das Spannungsfeld zwischen zwei Welten wird deutlich.

2011 beginnt eine Beziehung mit dem Pop- und Mundartmusiker Florian Ast, dem „Rebellen“ der Szene. Das Duo-Album „Lago Maggiore“ stürmt von Null auf Eins – öffentlich ein Traumpaar, privat eine wachsende Last. 2012 kommt der Bruch, begleitet von Boulevardwirbeln um neue Bindungen. Jordi reagiert mit ihrem Markenzeichen: Stille, Gelassenheit, ein einziger Satz, der bleibt – es gebe Dinge, die man mit Würde trage. Aus dieser Phase entstehen Lieder, die reifer klingen, wärmer, näher an der Erfahrung als an der Pose. Das Publikum dankt es: Authentizität wird zu ihrer stärksten Währung.
Das späte Bekenntnis
Frühjahr 2025. Ein Auftritt als Mentorin bei einem Musik-Event, Zürich. Kein Kalkül, keine Inszenierung. Auf die Frage nach dem Privatleben antwortet sie ohne Umwege: Ja, sie sei verliebt – in einen „wunderbaren Menschen“, 15 Jahre jünger. Ein Raunen, Applaus, und vor allem: Souveränität. „Die Liebe kommt nicht, wenn man sie plant“, sagt Jordi. „Sie kommt, wenn man bereit ist, das Herz wieder zu öffnen.“
Es ist ein Satz, der über die Person hinausweist. Denn Frauen jenseits der 40 werden im Kulturbetrieb noch immer in Rollen geschoben – Mutter, Autorität, aber selten Liebende. Jordi weigert sich, diese Drehbücher zu spielen. Sie macht aus einer privaten Tatsache ein öffentliches Statement: Liebe kennt kein Alter, keinen Erwartungsdruck. Viele reagieren mit Zustimmung, insbesondere Frauen mittleren Alters. Die Botschaft: Selbstbestimmung statt Rechtfertigung.
Auch im Umgang mit der medialen Enthüllung bleibt Jordi bei ihrer Regel „Würde vor Wirkung“. Keine großen Gesten, keine Zurschaustellung. Sie spricht offen, aber nie indiskret; sie akzeptiert, dass die Öffentlichkeit wissen will – und setzt doch Grenzen. Es ist die Kunst des Dosierens, die sie seit Jahren beherrscht: genug Nähe, um echt zu wirken; genug Distanz, um intakt zu bleiben.
Kunst als Kontinuum

Aus dem Geständnis wird ein kreativer Impuls. Neue Songs entstehen, weniger Sehnsucht, mehr Erfüllung; weniger Maske, mehr Innenstimme. Wer ihre Laufbahn verfolgt, erkennt darin keinen Bruch, sondern eine konsequente Fortsetzung: Jordi war immer am stärksten, wenn sie Erfahrung in Klang verwandelte. Ihre Stimme – jener helle, zugleich erdige Ton – trägt heute mehr Leben als Glanz. Sie singt nicht über, sie singt aus der Liebe, aus dem Verlust, aus dem Frieden, den man sich erarbeitet.
Dass parallel ihr Kochbuch, ihr TV-Geschick und ihr Image der Nahbarkeit funktionieren, ist kein Zufall. Bei Jordi stützen sich die Rollen gegenseitig: die Sängerin, die Gastgeberin, die Mentorin. Es ist das Bild einer Künstlerin, die nicht zwischen Marke und Mensch aufgerieben wird, sondern beides auf eine seltene Weise zusammenführt.
Was bleibt
Mit 48 steht Francine Jordi für eine Mischung, die im schnellen Kulturbetrieb rar geworden ist: Beständigkeit ohne Müdigkeit, Reife ohne Schwere, Erfolg ohne Zynismus. Die Schweiz erkennt in ihr ein Spiegelbild der eigenen leisen Tugenden – Verlässlichkeit, Maß, Zugehörigkeit –, aber auch den Mut, Grenzen zu verschieben, wenn das Leben es verlangt. Ihre Karriere ist kein Komet, der verglüht, sondern ein Kurs, der sich stetig justiert: von den Hotelbühnen der Kindheit über Wettbewerbe und Charts bis zu den großen Konzertsälen und den intimen Gesten des Alltags.
Vielleicht ist es das, was die neue Liebesgeschichte so bedeutsam macht: Nicht der Altersunterschied, nicht die Schlagzeile, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der sie gelebt wird. Jordi zeigt, dass das Herz kein Kalender ist. Dass Schönheit nicht im Gesicht wohnt, sondern – wie sie einmal formulierte – in dem Licht, das aus dem Inneren strahlt. Wer sie heute auf der Bühne erlebt, spürt diesen inneren Frieden: weniger Pose, mehr Präsenz; weniger Show, mehr Substanz.
Und so erzählt ihre Biografie, bei allen Brüchen, vom gleichen Grundthema: Treue. Treue zur Musik, zur Herkunft, zur eigenen Stimme. Treue zu dem, was man fühlt, wenn Scheinwerfer und Kameras verstummen. Aus dieser Treue wächst jene Wärme, die ein Publikum über Jahrzehnte bindet. Und aus ihr speist sich eine Ausstrahlung, die Titel wie „schönste Schweizerin“ erst mit Bedeutung füllt.

Am Ende bleibt ein Bild: eine Künstlerin, die nach einem Vierteljahrhundert im Licht nicht heller wirkt, weil die Spots stärker werden, sondern weil sie selbst klarer geworden ist. Klarer in der Kunst, klarer im Leben. Eine Frau, die nicht die Perfektion sucht, sondern die Stimmigkeit. Eine Stimme, die uns erinnert, dass Größe nicht Lautstärke ist – sondern Haltung. In der Schweiz, in Deutschland, überall dort, wo man ihr zuhört, klingt dieses Echo nach. Und es klingt nach Zukunft.