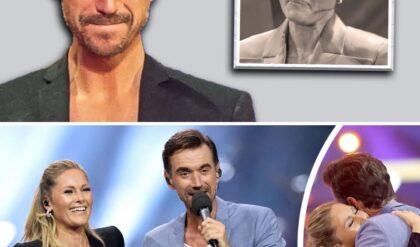Und dann zählte sie auf, was in den Ohren vieler Muslime wie eine Kriegserklärung klingen muss: “Beschneidungsverbot, Moscheeverbot, Minarettverbot, Burkini-Verbot, Burka-Verbot, Kopftuchverbot.”
Ihre Anklage war klar: Diese endlose Kette von Verboten und Debatten sei es, die Muslime ausgrenze und das Gefühl vermittle, nicht dazuzugehören. Die obsessive Fokussierung auf ein paar hundert vollverschleierte Frauen in Deutschland, so die Implikation, sei ein reines Ablenkungsmanöver. Ein Manöver, um von der eigenen Heuchelei, den eigenen völkerrechtlichen Verbrechen und dem eigenen Versagen in der Integrationspolitik abzulenken. Sie warf der Mehrheitsgesellschaft vor, den Dialog zu verweigern, indem sie ständig neue rote Linien ziehe und Muslime unter Generalverdacht stelle.
In diesem Moment wurde klar, dass es in dieser Debatte zwei völlig unterschiedliche Narrative gibt, die unvereinbar nebeneinander stehen.
Für die eine Seite ist die Vollverschleierung das ultimative Symbol der Unterdrückung, der Frauenfeindlichkeit, der Segregation und einer politischen Ideologie, die die offene Gesellschaft bedroht. Es ist die Angst vor dem Fremden, das sich nicht zeigen will, die Angst vor dem Verlust der eigenen kulturellen Selbstverständlichkeit. Es ist der Schrei nach klaren Regeln und der Verteidigung der “westlichen Zivilisation”, die auf dem offenen Visier basiert.
Für die andere Seite ist die Burka-Debatte das ultimative Symbol der westlichen Doppelmoral. Es ist der Schmerz, ständig für die Verbrechen anderer (Terroristen, Diktatoren) in Haftung genommen zu werden. Es ist die Frustration darüber, dass die eigene Religionsausübung – und sei sie noch so minoritär – ständig auf dem Prüfstand steht, während die eigenen Verfehlungen des Westens ignoriert werden. Es ist der Verdacht, dass “Frauenrechte” und “Integration” nur als Vorwand benutzt werden, um eine unliebsame Minderheit zu disziplinieren.
Diese Diskussion hat keinen Sieger hervorgebracht, und das konnte sie auch nicht. Sie hat einen Riss offengelegt, der tief durch Deutschland geht. Die Frage “Gesicht zeigen – Ja oder Nein?” ist zu einer Chiffre geworden für einen viel größeren Kampf: Wie viel Fremdheit hält eine Gesellschaft aus? Wo endet die individuelle Freiheit und wo beginnt der Schutz der Gemeinschaft? Und wer definiert überhaupt, was “unsere Kultur” ist?
Die Debatte um den Schleier wird weitergehen. Sie wird emotional und unversöhnlich geführt werden. Aber vielleicht ist das Wichtigste, was wir aus dieser Konfrontation lernen können, die Erkenntnis von Frau Hübsch: Unser subjektives Unbehagen, so stark es auch sein mag, darf nicht automatisch zur Grundlage von Verboten werden. Und vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis aus der Angst des anderen Gastes: Wenn Menschen sich bedroht fühlen, muss man ihre Angst ernst nehmen, selbst wenn man ihre Schlussfolgerungen für falsch hält.
Am Ende bleibt der Schleier ein Spiegel. Er zeigt uns nicht, wer die Frau darunter ist. Er zeigt uns, wer wir selbst sind: eine Gesellschaft, die zutiefst verunsichert ist und um ihre eigene Identität ringt.