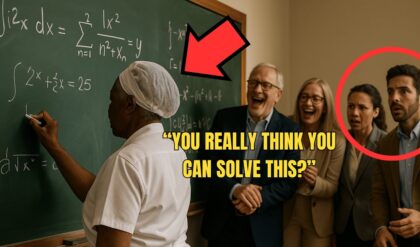Ein familiäres Mordunternehmen, das sich über Generationen hätte fortsetzen können. Die Ermittlungen zeigten schließlich, wie und warum die Mordserie endete. Johann Schwarz starb 1897, zwe Jahre nach der Aufnahme des Familienportraits unter mysteriösen Umständen. Laut Berichten der Augsburger Allgemeinen Zeitung sei er von einem Rind zu Tode getrampelt worden.
Doch moderne Analyse dieser Artikel offenbarte deutliche Widersprüche. Zeugen hatten in jener Nacht einen Fremden auf dem Hof gesehen. Es gab Spuren eines Kampfes, die nicht zu einem Unfall mit Vie passten. Margaretes Tagebuch enthielt einen kryptischen Hinweis auf den, der entkommen ist und die zunehmende Paranoia ihres Vaters vor seinem Tod.
Offenbar war einer der vorgesehenen Opfer geflohen oder hatte Rache geübt. Johanns Tod beendete die Mordserie schlagartig, doch er beseitigte auch den Hauptzeugen, der über die Verstecke der Leichen hätte Auskunft geben können. Kurz nach dem Tod ihres Mannes verkaufte Mattha schwarz den Hof und zog mit den Kindern nach Berlin, wo sie unter neuen Namen ein unauffälliges Leben in der Großstadt führten.
Die Sammlung der Skalps nahmen sie jedoch mit, sorgfältig verpackt und gut versteckt. Thomas, der älteste Sohn, fiel im Ersten Weltkrieg und nahm sein Wissen über die Familienverbrechen mit ins Grab. Maria, das mittlere Kind, starb 1918 an der spanischen Grippe. Nur Margarete überlebte bis ins hohe Alter und trug das dunkle Familiengeheimnis bis 2023 mit sich.
Das Verschwinden der Familie in den Berliner Arbeitervierteln schützte sie jahrzehntelang vor Ermittlungen. Erst die forensische Untersuchung des Portraits 2023 brachte die Wahrheit ans Licht. Das bayerische Landeskriminalamt nutzte modernste Verfahren, um jedes Detail des Fotos auszuwerten. Hochauflösende Scans machten acht einzelne Scalps mit unterschiedlichen Merkmalen erkennbar.
Verschiedene Haarfarben, Strukturen, Altersgruppen und ethnische Merkmale der Opfer. Besonders auffällig war ein Skypmuster mit geflochtenem Haar, das auf Angehörige einer osteuropäischen Romgruppe hindeutete, die im 19. Jahrhundert häufig als Saisonarbeiter durch Bayern zog. Das führte zu einer Zusammenarbeit mit Historikern und Vertretern dieser Gemeinschaft.
Die Analyse ergab außerdem, daß die Scalps chronologisch geordnet und mit professionellen Konservierungsmethoden behandelt worden waren, ein klares Zeichen für langfristig geplante Morde. Parallel dazu setzten die Ermittler Gesichtserkennungstechnologie ein, um biometrische Profile der Familienmitglieder zu erstellen und mit historischen Mde und Sterberegistern abzugleichen.
So konnte die Identität von Johann, Martha, Thomas, Maria und Margarete Schwarz zweifelsfrei bestätigt werden. Die digitale Verstärkung der Fotodetails brachte noch weitere grausige Hinweise zutage. An der Salonwand hingen neben den Scals persönliche Gegenstände der Opfer, Schmuck, Taschenuhren, Broschen. Diese umfassende Analyse verwandelte einziges historisches Familienfoto in ein vollwertiges Tatortdokument, das die Ermittlungen in einem mehr als 120 Jahre alten Serienmordfall revolutionierte.
Die Polizei arbeitete dabei eng mit Genealogen, Historikern und Romavertretern zusammen, um den Opfernamen und Geschichten zurückzugeben. Die Identifikation der geflochten Strähne führte zu einer engen Zusammenarbeit mit osteuropäischen Gemeinschaften, deren mündliche Überlieferungen ebenfalls Hinweise auf Menschen gaben, die auf Handelsrouten verschwunden waren.
Ein Historiker erklärte bei einem Treffen mit Ermittlern: “Uns Familiengeschichten erzählen von Leuten, die einst nach Bayern zogen, um zu arbeiten und nie zurückkehrten. Diese Fälle von Verschwinden wurden lange Zeit als Unfälle oder als Folgen von Verehrungen erklärt. Doch inzwischen ist klar, dass einige dieser Menschen ermordet und ihre Überreste als makabre Trophäen entwendet wurden.
Die Untersuchung ergab außerdem, dass mehrere Haarproben, die auf der alten Fotografie zu sehen waren, mit den Beschreibungen vermisster Personen aus Einwanderergerergemeinschaften im Raum München übereinstimmten. Irische, italienische und osteuropäische Familien hatten Ende des 19. Jahrhunderts Verwandte als vermisst gemeldet, die beim Reisen durch ländliche Regionen Oberbayerns verschwunden waren, oft auf dem Weg zu Arbeitsstellen oder Handelsgeschäften in kleineren Städten wie Freising oder Ingolstadt.