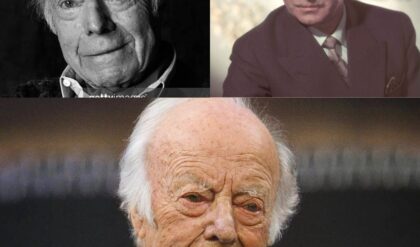-
Tag eins, Boden reichhaltig, Bäche klar, Fundamente der Häuser noch stark.
-
Tag zwei, hörten gestern Abend Gesang, klang wie ein Kind, kein Kind hier.
-
Tag drei, Kochfeuer roch nach Fleisch, obwohl wir nur Brot mitbrachten.
-
Tag vier, Elise am Waldrand. Bewegte sich nicht, blinzelte nicht. Einer unserer Männer schwor, sie lächelte.
-
Tag fünf. Die Seiten verschmiert, unleserlich, obgleich ein Wort entziffert werden kann: Aß.
Die Gruppe kehrte nie zurück. Ihre Vorräte wurden Monate später ordentlich am Straßenrand gestapelt entdeckt, als warteten sie darauf, inventarisiert zu werden.
Mit der Zeit wurde Greybrook aus den Bezirksaufzeichnungen gelöscht. Der Name tauchte nicht mehr in Urkunden, Testamenten oder Pfarreilisten auf. Straßen wurden neu gezeichnet. Hecken erweitert. Karten ohne seine Erwähnung eingefärbt.
Doch Abwesenheit löscht den Appetit nicht aus. Der Nebel zieht immer noch dick durch dieses Tal. Reisende riechen immer noch Fleisch in der Luft, wo kein Feuer brennt.
Und in Gasthöfen entlang der Bezirksgrenze senken alte Männer immer noch ihre Stimmen, wenn das Thema auf die Zofe kommt, die Rache servierte. Sie sagen, sie sei nicht an Stein oder Boden gebunden, dass jeder Tisch ihr gehören kann, jede Küche ihre Küche, jede Familie ihr Festmahl.
In einem Bericht aus dem Jahr 1862 hielt ein aus dem Krieg zurückkehrender Soldat in einer Taverne am Straßenrand an. Er behauptete, der Eintopf roch zu reichhaltig, zu süß, obwohl er seit Monaten kein Fleisch mehr gegessen hatte. Der Wirt servierte ihn mit Stolz. Doch als der Soldat die Brühe kostete, spuckte er sie aus und beharrte darauf, sie schmeckte nach Rauch und Wiegenliedern.
In dieser Nacht schwor er, er sah Elise im Tavernenfenster, ihre Silhouette war gegen das Feuer umrahmt. Er ging vor Tagesanbruch, lief 30 Meilen ohne anzuhalten. Die Taverne brannte im folgenden Winter nieder. Es wurde nie eine Ursache gefunden.
So verweilt die Geschichte, nicht in Aufzeichnungen, sondern im Atem, von Mund zu Ohr weitergegeben, geflüstert wie ein Tischgebet vor den Mahlzeiten: ««Sie hat ihnen ihre eigene Tochter serviert. Sie wird Ihnen Ihre eigene servieren.»»
Kinder fordern sich gegenseitig heraus, das Wiegenlied nachts zu singen, es zu summen, während ihre Mütter Eintopf zubereiten. Wenige erreichen die letzte Strophe. Noch weniger geben zu, was sie danach im Fenster sahen.
Und doch, lauscht genau. Auch jetzt bleibt das Muster. In Häusern, in denen Familien in Stille essen, klappert das Besteck manchmal, obwohl keine Hand es bewegt. In Küchen, in denen Brot geschnitten wird, blutet der Laib leicht in seiner Mitte.
In Salons, in denen Porträts hängen, scheinen sich Gesichter zu verschieben, ihre Münder kräuseln sich zu hungrigen Lächeln, und immer ist da eine Gestalt im Augenwinkel, eine Zofenuniform, ordentlich und gebügelt, ein geneigter Kopf, gefaltete Hände, wartend.
Verwechseln Sie ihre Geduld nicht mit Gnade. Sie hetzt nicht, weil Hunger nicht hetzt. Appetit wartet. Er kehrt immer zurück.
Und wenn Sie zu Tisch sitzen, wenn der Eintopf vor Ihnen zu reichhaltig, zu schwer riecht, fragen Sie sich: «Wessen Tochter esst Ihr?»
Greybrook ist fort. Doch der Nachgeschmack verweilt, ein Dorf konsumiert, eine Familie verschlungen, eine Zofe, die ihre Stellung überschritt, um Mund und Erinnerung zu werden. Die Mahlzeit geht weiter, Gang für Gang, bis der Tisch sich in die Ewigkeit dehnt.
Und irgendwo außer Sichtweite, aber niemals unerreichbar, wacht Elise, nicht mit Bosheit, nicht mit Mitleid, sondern mit der einfachen Unausweichlichkeit des Hungers. Wenn Sie das Wiegenlied heute Abend hören, folgen Sie ihm nicht. Summen Sie nicht mit. Und vor allem, setzen Sie sich nicht an den Tisch, denn Elise serviert keine Rache mehr. Sie serviert Sie.