Die Anatomie des Schreckens: Wie der 14-jährige „Boy A“ mit dem Mord an Jun Hase die moralischen Fundamente Japans erschütterte
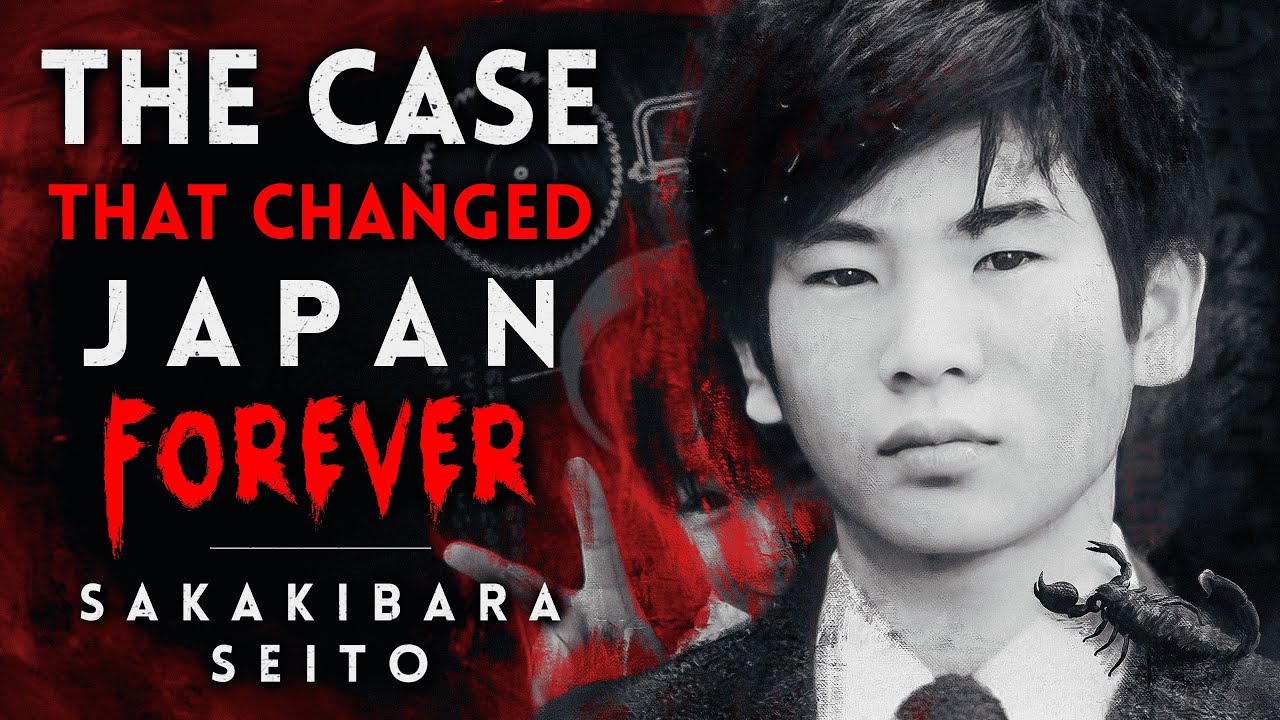
Die Anatomie des Schreckens: Wie der 14-jährige „Boy A“ mit dem Mord an Jun Hase die moralischen Fundamente Japans erschütterte
Japan gilt international als Musterbeispiel für eine sichere und zivilisierte Gesellschaft. Doch als die Stadt Kobe 1997 in den Sog einer beispiellosen Mordserie geriet, zerbrach dieses Bild in Tausend Stücke. Der Fall, der als der „Sakakibara Seito-Vorfall“ in die Geschichte einging, schockierte die Nation nicht nur wegen seiner unvorstellbaren Grausamkeit, sondern vor allem wegen der schockierend jungen Identität des Täters.
Für viele Japaner ist dieser regional verortete Fall bis heute der Inbegriff des abscheulichsten Verbrechens in der modernen Ära. Es war eine Geschichte von Hass, Isolation und einem kalten, fast wissenschaftlichen Verlangen, die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens zu testen.
Die Schatten über Kobe: Eine Serie von Angriffen
Der Schrecken begann bereits Monate vor dem entsetzlichen Höhepunkt. Im Februar 1997 wurde eine Reihe von Angriffen auf junge Schülerinnen in Kobe verzeichnet. Zwei Mädchen wurden auf ihrem Heimweg mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen, überlebten jedoch glücklicherweise. Der Täter, ein unheimlicher Schatten, entkam jedes Mal.
Am 16. März schlug derselbe Täter erneut zu. Die zehnjährige Ayaka Yamashita wurde wiederholt mit einem Hammer attackiert und erlag eine Woche später ihren schweren Kopfverletzungen. Nur zehn Minuten später attackierte er die neunjährige Kazumi Ishikawa, die in den Bauch gestochen wurde. Wie durch ein Wunder überlebte Kazumi, da die Klinge ihre Wirbelarterie nur knapp verfehlte. Entscheidend war jedoch, dass sie als Einzige einen genauen Blick auf das Gesicht ihres Angreifers erhaschen konnte.
Die Ermittler erkannten sofort ein Muster. An den Orten der Angriffe hinterließ der Mörder seine makabre Visitenkarte: verstümmelte Tierkadaver. Eine kopflose Taube hier, der Kopf eines Ferkels dort – ein unmissverständlicher Hinweis auf eine gestörte Psyche und eine Art okkultes Ritual. Die Bevölkerung, die nach einer zweimonatigen Pause gerade erst wieder aufzuatmen wagte, wurde bald mit einem noch viel größeren Albtraum konfrontiert.
Das grausame Manifest des Sakakibara Seito
Am 24. Mai verschwand der elfjährige Jun Hase. Drei Tage später, am Morgen des 27. Mai 1997, machte der Hausmeister der Tomogawka Junior High School in Suma eine Entdeckung, die die Nation bis ins Mark erschütterte. Zuerst bemerkte er die Überreste von zwei verstümmelten Katzen, dann, am Fuß des Haupttores, lag der abgetrennte Kopf des vermissten Jun Hase.
Der Anblick war entsetzlich: Die Augenhöhlen des Jungen waren leer, kleine X-Markierungen waren in die Haut geschnitten und sein Mund war von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. In diesem aufgeschlitzten Mund befand sich eine zusammengeknüllte Papiermitteilung, geschrieben in roter Tinte. Die Nachricht war ein höhnisches, blutiges Manifest an die Polizei: „Dies ist der Beginn des Spiels. Polizisten, stoppt mich, wenn ihr könnt. Ich sehne mich verzweifelt danach, Menschen sterben zu sehen. Es ist ein Nervenkitzel für mich, einen Mord zu begehen. Ein blutiges Urteil ist für meine Jahre großer Bitterkeit nötig.“ Unterschrieben war die Nachricht mit einem Alias, der später berühmt werden sollte: Sakakibara Seito. Das Pseudonym wurde aus den Kanji-Zeichen für „Teufel“, „Rose“ und „Heiliger“ zusammengesetzt.
Juns enthaupteter Körper wurde später auf dem Tank Mountain gefunden, verborgen unter den Dielen einer verfallenen Antennenstation. Es wurde schnell festgestellt, dass der Kopf mit einer Handsäge abgetrennt und mit demselben Werkzeug verstümmelt worden war.
Hass auf ein System: Die Wut hinter den Taten
Nur anderthalb Wochen nach der Tat erhielt die Redaktion der Kobe Shimbun einen dreiseitigen Brief. Der Absender, der sich als Juns Mörder ausgab, schrieb in einem 1400 Wörter umfassenden Erguss über seinen Wahn. Er beschrieb das Töten als einen Akt der „Befreiung vom ständigen Hass“ und als das einzige Mittel, um „Frieden zu erlangen“.
Der Schlüssel zu seinem Motiv war sein tiefer Hass auf das japanische Bildungssystem, das ihn zu einer „unsichtbaren, isolierten und einsamen Person“ gemacht habe. Diese Wut nährte seinen Drang, Schulen ins Visier zu nehmen.
Als die japanischen Medien seinen Namen fälschlicherweise als „Onibara“ (Teufelsrose) meldeten, reagierte der Täter mit kalter Wut und sandte eine weitere Drohung an einen Nachrichtensender. Er kündigte an, jede Woche „drei Gemüse“ zu vernichten, falls sein Alias erneut falsch zitiert oder seine Stimmung verdorben würde. Mit „Gemüse“ meinte er die allgemeine Bevölkerung – ein Ausdruck der extremen Entmenschlichung.
Entlarvt: Boy A und die schockierende Wahrheit
Die Ermittler konzentrierten ihre Suche schließlich auf eine junge Person mit einer Vorgeschichte der Quälerei von Tieren. Mit Hilfe der Augenzeugenaussage der überlebenden Kazumi Ishikawa hatten sie genug Anhaltspunkte. Am 28. Juni, nur einen Monat nach der Entdeckung von Juns Kopf, wurde das Ende des Albtraums verkündet: Ein 14-jähriger Tatverdächtiger war in Verbindung mit Juns Mord festgenommen worden.
Die Öffentlichkeit war fassungslos. Aufgrund strenger japanischer Datenschutzbestimmungen wurde der Name des Jungen jahrzehntelang geheim gehalten und er wurde lediglich als „Boy A“ bezeichnet. Später wurde seine wahre Identität als Shinichiro Azuma enthüllt, ein Nachbar von Jun Hase und selbst Schüler der Tomogawka Junior High.
Azuma gestand, Jun am 24. Mai auf den Tank Mountain gelockt zu haben, unter dem Vorwand, ihm eine Riesenschildkröte am Wassertank zeigen zu wollen. Dort erdrosselte er den Jungen mit einem Schnürsenkel und versteckte die Leiche in einer verlassenen Hütte. Am nächsten Tag kehrte er mit einer Handsäge zurück, um den Kopf abzutrennen. Was er danach schilderte, war jenseits jeglicher Vorstellungskraft: Er gab an, etwas von dem „reinen Blut“ des Jungen getrunken zu haben, um sein eigenes, das er für „schmutzig“ hielt, zu reinigen. Außerdem entfernte er Juns Augen, um seine Seele zu extrahieren.
„Heilige Experimente“: Das dunkle Innenleben des Täters
Azuma gestand nicht nur den Mord an Jun Hase, sondern auch die früheren Angriffe auf die vier Schülerinnen, einschließlich des Todes von Ayaka Yamashita. Seine Motive waren eiskalt und unpersönlich. Er sagte, er habe Jun als leichtes Ziel betrachtet und am Tattag lediglich ein starkes Verlangen gehabt, jemanden zu töten.
Seine Tagebücher lieferten erschreckende Einblicke in seine Gedankenwelt. Bezüglich Ayakas Angriff schrieb er: „Heute führte ich heilige Experimente durch, um zu bestätigen, wie zerbrechlich menschliche Wesen sind.“ Die Kaltblütigkeit, mit der er den Tod des Mädchens zur Kenntnis nahm, war schockierend: „Heute Morgen sagte meine Mutter, das arme Mädchen, das angegriffen wurde, sei wohl gestorben. Es gibt kein Zeichen, dass ich gerufen werde. Ich danke dir, Shin, dass die Polizei mich weiterhin schützt.“
Die Verteidiger von Shinichiro Azuma versuchten, seine Schuld anzufechten. Sie argumentierten, dass die Notizen und Briefe an die Medien komplexe Redewendungen und komplizierte Kanji-Zeichen enthielten, die ein Schüler mit Azumas mittelmäßiger Intelligenz unmöglich hätte verfassen können. Sie verwiesen auch auf Widersprüche in seinem Geständnis. Doch Japans Justizsystem, berüchtigt für seine hohe Verurteilungsrate, befand ihn des Mordes an Ayaka Yamashita und Jun Hase für schuldig und schickte ihn in eine Jugendstrafanstalt.
Die Rückkehr des Verurteilten: Profit aus der Tragödie
Nach weniger als sieben Jahren Haft wurde der damals 21-jährige Azuma im März 2004 freigelassen, da Sachverständige ihn für „geheilt von seinem Sadismus“ erklärten. Was danach geschah, war eine zweite Welle der Empörung. Azuma veröffentlichte die Memoiren seiner Morde unter dem Titel Zeka, in dem er sogar „unsagbare Dinge“ schilderte, die er mit Juns Kopf getan hatte.
Trotz des öffentlichen Aufschreis und der Versuche, die Veröffentlichung zu blockieren, wurde das Buch in Japan ein Nummer-eins-Bestseller. Azuma wurde zu einem wohlhabenden Mann. Als perverse Geste der Entschuldigung schickte er den Familien seiner Opfer ein persönliches Entschuldigungsschreiben, dem er eine Ausgabe seines Buches beilegte – ein Akt, der von vielen als unerträgliche Verhöhnung empfunden wurde.
Später, im Jahr 2015, gründete Shinichiro Azuma sogar eine eigene Website mit dem Titel „Die unerträgliche Transparenz des Seins“, die mit bizarren, selbstverherrlichenden Fotos von ihm selbst gefüllt war. Psychologen diagnostizierten in seinem Verhalten eine extreme Selbstbezogenheit und die verzweifelte Gier nach öffentlicher Aufmerksamkeit.
Ein Erbe des Drucks und der Isolation
Der Fall Sakakibara Seito hatte nicht nur psychologische, sondern auch weitreichende rechtliche Folgen für Japan. Er führte zur Senkung des Mindestalters für die Strafmündigkeit von 16 auf 14 Jahre.
Doch der Fall beleuchtete auch die tief sitzenden Probleme in der japanischen Gesellschaft. Azuma zeigte bereits in jungen Jahren Warnzeichen: Er trug heimlich scharfe Werkzeuge mit sich, quälte Tiere (er überfuhr Frösche mit seinem Fahrrad und köpfte Katzen) und litt unter dem Hikikomori-Syndrom, einer schweren Form des sozialen Rückzugs, die oft durch den immensen Leistungsdruck ausgelöst wird. Azumas Mutter hatte ihren Erstgeborenen extremen schulischen Erwartungen ausgesetzt.
Kritiker argumentieren, dass die Gesellschaft und ihr Bildungssystem, die junge Menschen unter einen solchen Druck setzen, dass sie sich in die Isolation flüchten und die Welt nur noch als „Gemüse“ wahrnehmen, selbst eine Mitschuld tragen.
Heute ist Shinichiro Azuma etwa 40 Jahre alt und lebt Berichten zufolge in Tokio, wo er als Mechaniker arbeitet. Er heiratete eine Bewunderin aus seinem Fanclub, mit der er eigene Kinder hat. Der Mann, der einst ein Kind mit einer Handsäge enthauptete und sich aus dem Blut seines Opfers reinigte, führt nun ein bürgerliches Leben. Die Frage, ob er irgendetwas fühlt, wenn seine eigenen Kinder auf dem Heimweg von der Schule sind, bleibt eine der dunkelsten und quälendsten Fragen dieses unvergesslichen Schreckens in der Geschichte Japans.





