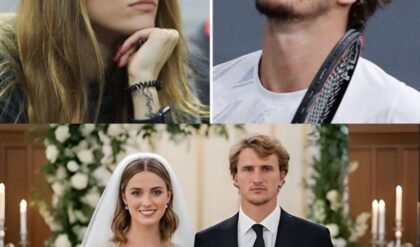Des Weiteren irritierte ihn eine skurril anmutende Aktion, bei der goldene Rettungsdecken, die eigentlich für die Versorgung von Brandopfern und in Notfällen benötigt werden, aus den Fenstern des Gebäudes gehängt wurden. Er wollte die genauen Hintergründe und die Kosten dieser Aktion in Erfahrung bringen, die er als Missbrauch von Hilfsmitteln empfand.
Doch es war die Frage nach den Prozesskosten, die den eigentlichen Eklat auslöste. Brandner wollte wissen, in welchem Verhältnis diese Kosten zum Gesamtvermögen des Vereins stehen und ob die Vorstandsmitglieder sich der Tragweite ihrer juristischen Entscheidung bewusst waren, die das finanzielle Fundament der Gedenkstätte ernsthaft bedrohen könnte.
Der Eklat: Kritik mit demonstrativem Applaus erstickt

Als Brandner in den verbliebenen Minuten versuchte, auch nur eine dieser Fragen anzuschneiden, wurde ihm der Raum zur Rede verwehrt. Der Vereinsvorsitzende fiel ihm laut Brandners Schilderung ständig ins Wort. Was diesen Vorgang jedoch besonders skandalös macht, ist die Reaktion der Anwesenden.
Von den etwa 65 Vereinsmitgliedern waren außer Brandner nur 16 weitere Mitglieder anwesend. Brandner berichtet, dass die Unterbrechungen durch den Vorsitzenden teilweise unter dem Applaus und der Beifallsbekundung dieser 16 Mitglieder stattfanden. Dies ist ein erschreckendes Zeichen dafür, dass eine kleine, geschlossene Gruppe die kritische Stimme eines Mitglieds systematisch zum Schweigen brachte und zensierte. In einem Verein, der sich dem Kampf gegen Diktatur und politische Verfolgung verschrieben hat, ist eine solche Zurschaustellung von Intoleranz und mangelnder Debattenkultur ein vernichtendes Urteil über die interne Vereinsdemokratie.
Brandners Fragen wurden nicht beantwortet, seine Kritik wurde nicht gehört. Die demokratischen Mechanismen des Vereins – nämlich die freie Meinungsäußerung und das Recht auf kritische Fragen in einer Mitgliederversammlung – wurden in einem Akt demonstrativer Ablehnung außer Kraft gesetzt.
Eine Gedenkstätte im Zwiespalt der Werte
Die Bilanz des Abends ist für Brandner eindeutig: Was sich in Gera abspielte, sei „wirklich unter aller Kanone“. Brandner betont die enorme Wichtigkeit des Vereins für die Erinnerungsarbeit an die Opfer politischer Verfolgung und bekräftigt, dass er gerne Mitglied dieses Vereins sei. Sein Engagement zielt darauf ab, den Verein „wieder auf den rechten Weg zu bringen, dahin zu kommen, was es mal war“.
Doch der Kontrast zwischen dem idealen Selbstverständnis des Vereins als Mahnmal gegen Diktatur und der erlebten, autoritären Praxis ist frappierend. Ein Verein, der mit Schülern die Aufarbeitung politischer Verfolgung betreibt, muss diese demokratischen Grundsätze im eigenen Haus vorleben. Die Verweigerung von Transparenz, die Unterdrückung von Kritik und die systematische Erstickung der freien Rede durch den Vorsitzenden und seine Unterstützer stellen eine eklatante Verletzung eben jener Werte dar, die der Verein nach außen hin verkörpern möchte.
Brandners persönliches Fazit zur politischen Stoßrichtung des Vereins ist daher unmissverständlich: „Keine Diktatur in Deutschland, nie wieder Sozialismus, weder brauner, roter und grüner auch nicht.“ Die Verhältnisse in Gera haben gezeigt, dass die Wachsamkeit gegenüber undemokratischen Tendenzen nicht nur nach außen, sondern auch in den eigenen Reihen – selbst bei einer Gedenkstätte – notwendig ist. Der Eklat von Gera steht somit als mahnendes Beispiel dafür, wie schnell auch Organisationen mit hehren Zielen ihre eigenen elementaren Grundsätze der Freiheit und des demokratischen Diskurses vergessen können, wenn Kritik unbequem wird und finanzielle Verantwortlichkeiten im Raum stehen. Die Öffentlichkeit hat nun ein Recht darauf zu erfahren, was in dieser wichtigen Gedenkstätte in Thüringen wirklich geschieht.