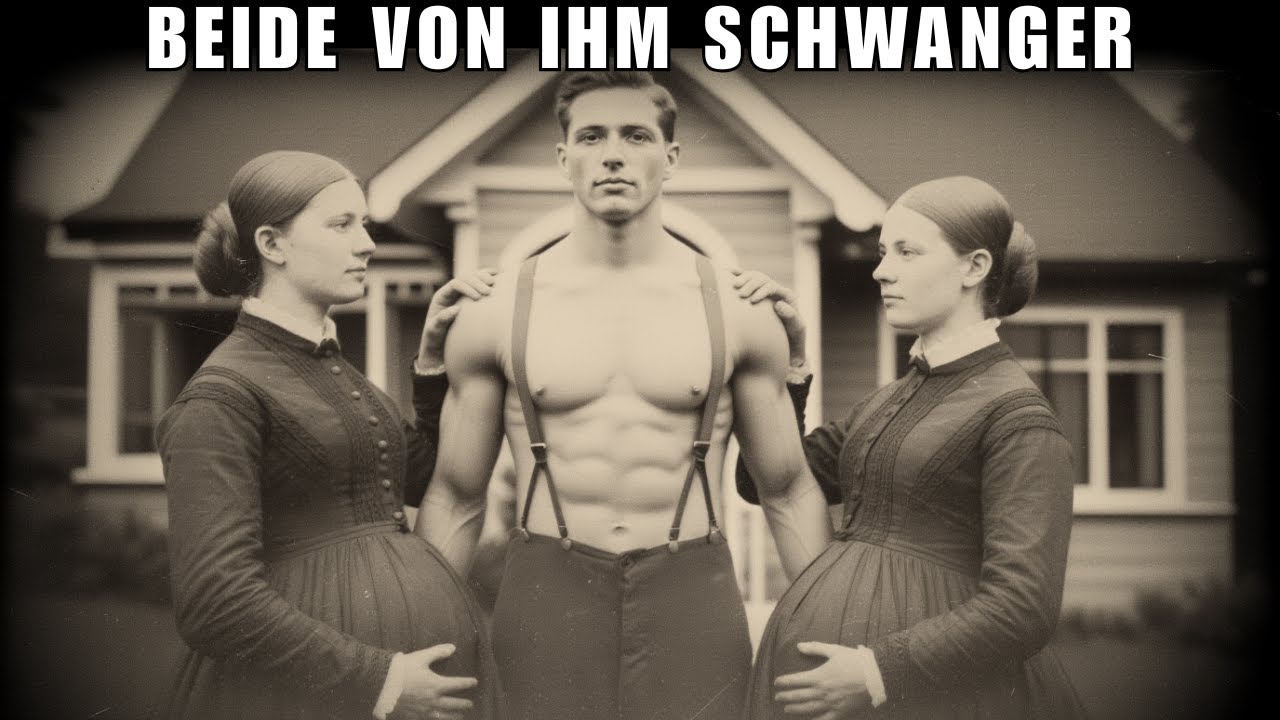
Das Haus hat sich selbst verbrannt. Er verließ das Krankenhaus im August und verschwand. Es gibt Berichte, daß er nach Norden ging. Manche behaupten, er sei in Hamburg gesehen worden, wo er in den armen Vierteln als Schreiber arbeitete. Andere sagten er sei in Dänemark gestorben, allein mit einem Stapel beschriebener Blätter auf dem Tisch.
Niemand weiß, was wirklich geschah. Erst im Jahr 1963 bei der Renovierung eines alten Kontorhauses in Lübeck fand man hinter einer Wand ein Bündel Dokumente in Ölpapier gewickelt. Auf dem Umschlag stand in verblassener Tinte die Chronik von Eichenbrunnen, aufgeschrieben von Markus Baumann. Zeuge.
Die Seiten waren versenkt, doch lesbar. Darin stand alles. Die Geschichte von Friedrich von Sebach, seinen Töchtern von Schuld, Erbe und Feuer. Die letzten Zeilen waren anders. Sie waren mit einer anderen Hand geschrieben, vermutlich später, vielleicht von Markus selbst, kurz vor seinem Tod.
Man sagt, Blut vererbt sich, aber das ist nicht wahr. Was sich vererbt, ist Schuld. Sie wandert von Generation zu Generation, bis jemand sie verbrennt. Ich habe gesehen, wie zwei Frauen versuchten, frei zu sein und wie sie dabei zu dem wurden, was sie vernichten wollten. Ich schreibe, weil ich leben muss. Ich lebe, weil ich schreibe.
Darunter mit zitternder Schrift: Eichenbrunn existiert nicht mehr. Aber manchmal, wenn der Wind aus dem Osten weht, riecht man noch Rauch. Die Chronik endete dort. Aber am unteren Rand des letzten Blattes stand in Bleistift, kaum lesbar. Nicht alles ist verbrannt. Nach der Veröffentlichung des Manuskripts im Jahr 1974 erklärte man es zur literarischen Fälschung.
Die Fachwelt sprach von gotischer Übertreibung, postromantischem Wahn, Symbolismus des Weiblichen. Niemand glaubte, dass die Ereignisse real waren. Doch in Hohenstedt, wo heute nur noch eine Wiese an der Stelle des Gutes liegt, erzählen alte Leute an stürmischen Abenden immer noch dieselbe Geschichte, dass man manchmal, wenn der Wind aus dem Süden kommt, die Glocke von Eichenbrunnen Leuten hört, obwohl dort keine Kirche mehr steht.
Viele Jahrzehnte vergingen und die Erinnerung an Eichenbrunn versank langsam in den Nebeln der Geschichte. Nur in Archiven, in vergilbten Akten und in einem Buch, das unter Historikern zirkulierte, blieb der Name bestehen. Doch im Jahr 1976 begann eine junge Historikerin aus Leipzig, Anna Reimers, das Archivmaterial zu untersuchen.
Sie war damals 27 Jahre alt, ehrgeizig und neugierig, und sie glaubte nicht an Geister, sondern an Dokumente. Eines Nachmittags erhielt sie aus Lübeck einen Umschlag ohne Absender. Darin befanden sich drei Seiten in verblaster Tinte, kopiert aus einem alten Manuskript. Oben stand aus der Chronik von Eichenbrunn, darunter ein Datum. 17. Mai 1849.
Anna lass die ersten Zeilen und spürte, wie etwas in ihr veränderte. Die Schrift war fein, altmodisch und die Worte trugen eine seltsame Kraft. Sie las bis spät in die Nacht und je weiter sie kam, desto weniger konnte sie aufhören. Jedes Leben beginnt mit einem Experiment, stand da. Und weiter. Wir sind die Ergebnisse der Entscheidungen anderer, aber manchmal kann man die Formel umkehren.
In den folgenden Wochen fuhr sie nach Lauenburg, um die Reste des Gutes zu suchen. Sie fand nichts, nur eine flache Wiese, ein paar Steine im Boden, überwuchert von Moos und Disteln. Ein alter Mann aus dem Dorf, der in einer Hütte nahe dem Fluss lebte, zeigte ihr die Stelle, wo der Brunnen gestanden hatte. Hier war das Herz des Hauses”, sagte er.
Manchmal riecht man im Herbst noch den Rauch und manchmal hört man ein Kind weinen. Anna lächelte höflich, doch in ihr wuchs ein Unbehagen. Sie beschloss, in Hohen Städt zu übernachten. Im kleinen Gasthaus am Marktplatz bekam sie ein Zimmer im Dachgeschoss. Die Wirtin, eine grauhaarige Frau mit wachen Augen, fragte sie, warum sie hier sei.
Ich forsche über das Guteichenbrunn, antwortete Anna. Die Frau schwieg einen Moment, dann sagte sie leise: “Manche Dinge sollte man nicht ausgraben. Sie liegen nicht ohne Grund im Dunkeln.” In jener Nacht konnte Anna nicht schlafen. Der Wind drang durch die Ritzen der Fenster und irgendwo im Haus knackte ein alter Balken. Gegen Mitternacht stand sie auf und öffnete die Fensterläden.
Draußen war der Himmel schwarz, aber über den Feldern leuchtete ein schwacher rötlicher Schein, als würde dort ein Feuer brennen. Sie starrte lange hinaus, dann schloss sie das Fenster. Ein Bauernfeuer”, sagte sie zu sich selbst. Doch das Knistern, das sie hörte, war kein Feuerholz. Es klang wie das Rascheln von Papier, das in Flammen aufgeht.
Am nächsten Morgen fuhr sie zum Stadtarchiv. Der Archiv war, ein alter Mann mit Nickelbrille, legte ihr eine Schachtel mit Dokumenten vor. “Mehr ist nicht geblieben”, sagte er. Anna öffnete sie. Darin lagen ein Dutzend Blätter, teilweise verkohlt, ein Siegel und ein kleiner Zettel, auf dem stand: “Nicht alles ist verbrannt.” Ihr Herz schlug schneller.
Unter den Papieren befand sich ein Brief, unterzeichnet von allem Markus Baumann. Er begann mit den Worten: “An den Finder, der glaubt, es sei vorbei. Nein, die Geschichte wiederholt sich, solange man sie nicht versteht.” Dann folgten Beschreibungen von Experimenten mit Blut, von Versuchen, die Vererbung des Gehorsams zu brechen, von zwei Frauen, die glaubten, Freiheit könne man erzwingen. Aber der letzte Absatz war anders.
Ich habe sie gesehen, wie sie in den Flammen standen. Ich habe geglaubt, sie seien tot. Doch in jener Nacht, als ich das Haus verließ, hörte ich hinter mir ein Kind schreien. Ich schwöre, ich habe es gehört. Vielleicht war es der Wind. Vielleicht nicht. Anna legte den Brief aus der Hand. Ihre Finger zitterten.
Sie spürte, daß sie etwas berührt hatte, das größer war als ein Mythos. Etwas, das noch nicht zu Ende war. Am Nachmittag besuchte sie die Pfahrkirche von Hohenstedt. In den Registern fand sie den Eintrag zur Beerdigung des Gutsbesitzers Friedrich von Sebach und daneben den Vermerk: “Zwei weibliche Personen ohne genaue Identität im Brand des Hauses verbrannt.
” Aber weiter unten in anderer Tinte stand eine dritte Zeile nachgetragen offenbar Jahre später. Ein Kind, männlich, ohne Namen, totgeboren oder verschwunden. Anna las die Zeile mehrfach, totgeboren oder verschwunden. Das Wort oder brannte sich in ihren Kopf. Am Abend kehrte sie auf das Feld zurück.
Die Sonne stand tief, das Licht war golden. Sie ging langsam, tastend, als könne sie etwas Unsichtbares spüren. Als sie den Brunnen erreichte, blieb sie stehen. Das Gras dort wuchs dichter, dunkler und plötzlich ohne Wind bewegte es sich. Ein Rascheln, kaum hörbar, dann stille. Sie beugte sich vor.
In der Tiefe des alten verfallenen Brunnens lag etwas. ein Stück Metall, rund, verrostet. Sie kniete, griff danach und als sie es in der Hand hielt, erkannte sie es. Ein kleiner Knopf, graviert mit den Buchstaben KV. Klarer Wah, ein leiser Windzug ging über die Wiese. Anna fröstelte. Sie wollte den Knopfen lassen, doch ihre Finger gehorchten nicht. Da hörte sie ein Geräusch, ein Flüstern, kaum mehr.
als ein Hauch. Schreib es auf. Sie ließ den Knopfen und rannte. Und der Wind hinter ihr klang wie das leise Umblättern einer Seite. Anna Reimers kehrte nach Leipzig zurück, doch sie nahm den Fund aus Hohenstedt mit, den Knopf, die Kopien, den Brief. Sie schwor sich, die Geschichte zu Ende zu bringen.
Wochenlang arbeitete sie in der Universitätsbibliothek, verglich Handschriften, suchte nach Hinweisen in alten Kirchenbüchern, Briefen, medizinischen Berichten. Je tiefer sie grub, desto mehr verwischte sich die Grenze zwischen Forschung und Obsession. Ihr Schreibtisch war bedeckt mit Notizen, Zeitungsausschnitten, Kopien, Alter Verträge.
Über allem lag das Gefühl, beobachtet zu werden. Eines Abends, spät im Juli, fand sie im Archiv der medizinischen Fakultät eine Mappe, die eigentlich gar nicht dort hätte sein dürfen. Sie war falsch einsortiert zwischen Dokumenten über Geburtsstatistiken und anatomische Studien. Auf dem Deckblatt stand in verblaster Tinte Projekt E. Abteilung für hereditäre Experimente Leipzig 1855.
Anna öffnete sie vorsichtig. Die ersten Seiten waren Berichte über Versuchsreihen, Zahlen, Skizzen menschlicher Organe. Doch zwischen den Protokollen lag ein einzelner Brief, datiert auf den 5. August 1855, unterzeichnet mit Dr. Karl Bering. Darin stand: Das Leipziger Projekt bleibt unvollständig. Das Subjekt weiblich entkam mit dem Kind.
Es wird angenommen, dass beide nach Norden geflohen sind. Die genetische Linie zeigt außergewöhnliche Stabilität. Beobachtung fortsetzen. Das Blut der Sebbach ist nicht erloschen. Anna ließ den Brief sinken. Ihr Herz pochte laut. Das Kind. Es war also nicht im Brunnen gestorben. In derselben Nacht rief sie einen Freund an, den Historiker Matthias Köhler und erzählte ihm alles. Er lachte nervös. Anna, das klingt wie ein Roman.
Vielleicht ist das alles eine Fälschung. Nein, sagte sie. Die Handschrift stimmt. Ich habe sie mit den Originalaufzeichnungen verglichen. Es ist echt. Und was willst du tun? beweisen, dass das Kind überlebt hat. Sie begann nach Spuren in den Kirchenbüchern des Nordens zu suchen. Hamburg, Lübeck, Flensburg.
In einem Register von 1965 fand sie einen Eintrag, der sie innerhalten ließ. Geburtsdatum 15. Mai 1856. Name: Elias Bering, Mutter unbekannt, Vater adoptiv, Elias. Anna notierte alles. Je mehr sie las, desto klarer wurde ihr, dass dieser Name in den späteren Jahrzehnten immer wieder auftauchte.
in wissenschaftlichen Zirkeln, in medizinischen Korrespondenzen, sogar in Kriegsdokumenten. Überall der gleiche Nachname. Bering. Männer und Frauen mit überdurchschnittlicher Intelligenz, kalter Rationalität, verbunden durch eine Linie, die sich nicht auslöschen ließ.
An einem Abend im September, es regnete, erhielt sie einen anonymen Anruf. Eine männliche Stimme sagte nur: “Frau Reimas, hören Sie auf. Manche Archive sind verschlossen, um Menschen zu schützen.” Dann legte er auf. In den Tagen danach bemerkte sie, dass jemand in ihrer Wohnung gewesen war. Ihre Notizen lagen anders. Die Tür klemmte, als wäre sie von innen geöffnet worden.
Sie wollte zur Polizei gehen, doch was hätte sie sagen sollen? Ich forsch über eine Familie, die es nicht mehr gibt. Am er. Oktober erhielt sie einen Brief ohne Absender. Darin lag ein einzelnes Foto. Alt, vergelbt. Darauf ein Mann, vielleicht 40 Jahre alt, in weißem Arztkittel. In der unteren Ecke stand Dr. Elias Bering, Institut für Verhaltensgenetik, Berlin 1933. auf der Rückseite in anderer Handschrift. Das Experiment endet nie.
A begann zu zittern. Sie suchte in den Registern der Universität Berlin. Es gab keine Einträge über einen Dr. Bering. Kein Nachweis, keine Personalakte. Nur ein Verweis in einem alten Artikel aus dem Jahr 1934. Einer der leitenden Forscher verließ das Land unerwartet. Das Institut wurde geschlossen. In dieser Nacht konnte sie nicht schlafen.
Sie hörte den Wind, das Klopfen an den Fensterläden und sie wusste, sie war zu weit gegangen, doch sie konnte nicht aufhören. Sie nahm das Foto, legte es neben ihre Notizen und begann zu schreiben. Die Linie ist nicht erloschen. Sie hat sich angepasst. Sie lebt unter anderen Namen, vielleicht in mir. Ihr letzter Eintrag im Forschungstagebuch datiert vom 10. Oktober 1977. Danach verliert sich ihre Spur.
Zwei Monate später fand man ihre Wohnung leer. Der Schreibtisch war umgestoßen, die Papiere verbrannt, das Fenster offen. Nur eines blieb zurück, der Knopf mit den Buchstaben KV. Er lag mitten auf dem Tisch. Sauber, als wäre er gerade dorthingelegt worden. Im Polizeibericht stand: “Keine Anzeichen für Gewaltanwendung.
Die Bewohnerin wird vermisst, Wohnung verschlossen, Geruch von Rauch wahrnehmbar. Seitdem wird sie in keiner Universitätskartei mehr geführt. Manche sagen, sie sei nach Skandinavien geflohen, andere sie habe Selbstmord begangen. Doch es gibt Menschen in Leipzig, die schwören, sie habe weitergeschrieben unter einem anderen Namen. Und manchmal, wenn jemand in alten Archiven blättert, findet er eine Notiz in einer fremden Handschrift am Rand eines Dokuments.
Nicht alles ist verbrannt. Jahr 1978 brachte keine Antworten, nur Spuren, die sich wie Risse durch das Gedächtnis derer zogen, die noch suchten. Nach Annas Verschwinden wurde ihre Wohnung versiegelt, die Unterlagen beschlagnahmt und die Universität erklärte ihr Projekt offiziell für eingestellt.
Doch ein Jahr später tauchten in einem Antiquariat in Hamburg drei Bücher auf, die ihren Namen trugen, jedoch mit einer merkwürdigen Widmung. In der Innenseite jedes Bandes stand in derselben klaren Schrift für E, damit er weiß, daß er war. Niemand konnte erklären, wer war. Im Winter jenes Jahres kam ein Mann in das Antiquariat, groß, schlank, mit grauem Mantel und einem Akzent, den man nicht einordnen konnte.
Er kaufte alle drei Bücher, bezahlte bar und verschwand. Der Verkäufer erinnerte sich nur an eines. Seine Augen, sie waren fast farblos, wie Glas. Die Spur verliert sich hier nicht, sondern teilt sich. In den Archiven der dänischen Universität Orhus tauchte 1981 ein Name auf. Elias Reimann. Geburtsort unbekannt, Beruf, Biologe.
Seine Unterschrift ähnte auffällig der von Dr. Elias Bering aus den dreißiger Jahren. Die offiziellen Unterlagen nannten ihn einen Forscher für molekulare Genetik, doch seine Arbeiten wurden nie veröffentlicht. Nur intern kursierten Berichte über ein geheimes Projekt, codiert als E47. In den Akten hieß es Untersuchung genetischer Gedächtnisübertragung, Leitung Eimann.
Einige Mitarbeiter behaupteten später, dass der Mann nie schlief, kaum sprach und nachts oft in seinem Labor blieb, während aus dem Keller ein leises Summen kam, wie von einem alten Generator. Niemand wusste, was er dort tat. Im Jahr 1985, am 13. Juni kam es zu einem Brand im Institut. Fünf Menschen starben, darunter Elias Reimann. Die Gebäude wurden versiegelt.
Nur ein einziger Gegenstand wurde aus der Asche geborgen. Ein kleiner verkohlter Metallknopf, graviert mit den Buchstaben KV. Die Behörden erklärten den Brand als Unfall. Doch ein junger Journalist aus Kopenhagen Lars Holm begann zu recherchieren. Er fand heraus, daß Reimannas Bering alias jemand anderes in einem alten Gutshaus am Rande von Orhus lebte.
Ein Haus, das von den Einheimischen das neue Eichenbrunn genannt wurde. Niemand wusste, wer diesen Namen geprägt hatte. Holm besuchte das Grundstück. Es lag verlassen, eingezäunt, das Dach halb eingestürzt, doch im Keller fand er etwas, das ihn verstummen ließ. Eine Reihe gläser Zylinder, leer, aber mit Rückständen einer durchsichtigen Flüssigkeit. An den Wänden waren Zahlen eingeritzt.
Römische Ziffern von I bis Druens wie die Monate oder wie Generationen. In der Mitte des Raumes stand ein alter Tisch, darauf eine einzelne unbeschriebene Seite Papier. In der Ecke, fast unlesbar stand eine Zeile. Das Blut der Sebbach schläft, aber es vergisst nicht. Holm nahm die Seite mit. Drei Wochen später starb er bei einem Autounfall auf der Straße nach Flensburg.
Sein Wagen brannte völlig aus, doch die Feuerwehr fand zwischen den Trümmern ein Stück Papier, unversehrt. Darauf stand mit Bleistift geschrieben: “Nicht alles ist verbrannt.” Danach verschwand auch diese Spur. Die Zeitung, für die Holm gearbeitet hatte, druckte keinen Nachruf. Seine Notizen wurden nie veröffentlicht.
Das Grundstück bei Ahus wurde verkauft, abgerissen und an seiner Stelle steht heute ein Wohnhaus mit zwölf Wohnungen. Die Anwohner berichten von nichts ungewöhnlichem, außer dass ihre Uhren manchmal gleichzeitig stehen bleiben, genau um Mitternacht. Im Jahr 2004 veröffentlichte eine dänische Historikerin Kären Blicks einen Aufsatz über mythische Erblinien in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Darin zitiert sie ein anonymes Manuskript, das sieht die 14.
Quelle nennt. Der Text endet mit einem Satz. Man glaubte, das Feuer habe alles beendet. Aber Feuer löscht keine Formeln. Es verändert sie. Blix schreibt: “Das Manuskript sei in den 70er Jahren in Kopenhagen aufgetaucht in der Handschrift einer Frau, deren Initialen AR lauteten. Damit schließt sich der Kreis.
Wenn man heute durch das Land zwischen Lauenburg und Hohenstedt fährt, sieht man nur Felder und Wälder. Doch Einheimische erzählen, dass dort, wo einst Eichenbrunn stand, manchmal Nebel aufsteigt, selbst im Sommer, und dass man darin Stimmen hört. Zwei Frauen, die miteinander flüstern.
Man sagt, die eine fragt, schreibst du? Und die andere antwortet: “Imer noch. Vielleicht ist das nur Aberglaube, vielleicht auch nicht. Denn jedes Mal, wenn der Wind sich dreht und der Himmel rot wird wie altes Eisen, riecht es nach Rauch und Tinte. Und irgendwo tief unter der Erde schläft ein Name, der darauf wartet, wieder aufgeschrieben zu werden.
Zwei Jahrzehnte verging. Die Geschichte von Eichenbrunnen war zu einem Mythos geworden, zu einem jener Schatten, die zwischen Fakten und Fabeln wandern. In Universitätskursen sprach man über sie als über ein literarisches Konstrukt, ein Sinnbild weiblicher Selbstbehauptung oder ein Echo des deutschen Idealismus. Niemand glaubte, dass es das Haus wirklich gegeben hatte.
Und doch irgendwo zwischen den Archiven, den vergilbten Blättern und den Erzählungen alter Dorfbewohner blieb etwas, das sich nicht erklären ließ, etwas, das nicht verbrannt war. Im Frühjahr 2008 zog eine junge Wissenschaftlerin namens Clara Reimann nach Berlin. Sie war Molekularbiologin, spezialisiert auf Epigenetik und arbeitete an einem Forschungsprojekt über die Vererbung traumatischer Erinnerung.
Sie war 35 Jahre alt, Tochter eines dänischen Vaters und einer deutschen Mutter, die früh gestorben war. Ihren Nachnamen trug sie aus Respekt vor ihrem Großvater, den sie nie kennengelernt hatte. Sie wußte nur, daß er Forscher gewesen war, verloren in einem Brand. Clara war rational, präzise, kontrolliert. Sie glaubte an Zahlen, nicht an Zufälle.
Doch eines Tages, als sie das Archiv ihres neuen Instituts durchforstete, fand sie in einer Kiste ohne Signatur ein Dokument, alt, handgeschrieben, an den Rändern versenkt. Oben stand in schwungvoller Schrift die Chronik von Eichenbrunnen. Fortsetzung. Sie runzelte die Stirn. Das Papier war brüchig, die Tinte braun geworden. Doch die Handschrift war überraschend lesbar. Sie begann zu lesen.
Der Text sprach von Feuer, Erbe und Formeln, die überleben. Und auf der letzten Seite am unteren Rand stand mit dünnem Bleistift geschrieben: “Für die, die das Blut tragen. Schreib weiter.” KA saß lange vor dem Blatt. Ein Zittern ging durch ihre Hände, obwohl sie nicht wusste, warum. Später erzählte sie sich selbst, daß es bloß Müdigkeit gewesen sei.
Aber noch in derselben Nacht träumte sie von einem Haus groß aus grauem Stein, mit hohen Fenstern und einem Turm, in dem eine Uhr stand, deren Zeiger rückwärts liefen. Sie ging durch die Flure, hörte Stimmen, zwei Frauen, die miteinander sprachen. Eine sagte, er schläft. Die andere, nein, er schreibt.
Dann wachte sie auf, schweißnass, mit dem Geschmack von Rauch auf der Zunge. In den folgenden Wochen begann sie das Manuskript zu analysieren. Sie verglich die Handschrift mit alten Briefen aus Leipzig und das Ergebnis ließ sie verstummen. eine Übereinstimmung von mehr als 90% mit den Notizen einer gewissen Anna Reimers vermisst seit 1977. Aber etwas irritierte sie mehr.
Auf der Rückseite des letzten Blattes waren DNA Spuren gefunden worden. Weiblich, modern, aus den 90er Jahren. Klara beantragte heimlich einen Abgleich. Das Ergebnis kam zwei Wochen später. Übereinstimmung 98%. Sie starrte auf das Blatt, unfähig zu atmen. Es war ihre eigene. In jener Nacht ging sie zum Institut allein.
Sie nahm das Manuskript, legte es unter das Mikroskop und im schwachen Licht des Labors sah sie etwas, das nicht dorthin gehörte. Winzige Schriftzüge mit bloßem Auge unsichtbar, eingebrannt in die Fasern des Papiers. Nur ein Satz sich wiederholend, Zeile für Zeile. Nicht alles ist verbrannt. Plötzlich erlosch das Licht.
Das Summen der Geräte verstummte, nur das rote Notlicht blieb. Und irgendwo im hinteren Teil des Labors hörte sie ein Geräusch, das leise Umblättern einer Seite. Sie rief: “Ist da jemand?” “Keine Antwort, nur der Geruch von Staub und heißem Metall. Als sie das Licht wieder einschaltete, lag auf ihrem Tisch ein Gegenstand, der vorher nicht dort gewesen war.
Ein kleiner runder Metallknopf, graviert mit den Buchstaben KV. Klara griff danach, doch ihre Finger bebten. In ihrem Kopf klang eine fremde, aber vertraute Stimme. Schreib weiter. Am nächsten Morgen fand der Sicherheitsdienst das Labor leer. Die Geräte liefen, aber niemand war da. Das Manuskript lag geöffnet auf dem Tisch.
Auf der letzten Seite unter der alten Tinte stand eine neue Zeile in moderner Handschrift hier endet es nicht. Heute im Jahr 2025 kursiert online eine Datei mit dem Titel Die Chronik von Eichenbrunnen. Vollständige Fassung. Niemand weiß, wer sie hochgeladen hat. Der Text enthält Passagen, die nie veröffentlicht wurden, Berichte, die bis in die Gegenwart reichen, Hinweise auf genetische Experimente, auf Nachkommen, die in verschiedenen Ländern leben. Manche Leser behaupten, beim Lesen den Geruch von Rauch zu spüren.
Andere sagen, sie hätten Stimmen gehört. Und jedes Jahr in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai erscheint auf der Website, auf der die Datei liegt, dieselbe Nachricht immer um Mitternacht. Nicht alles ist verbrannt.



