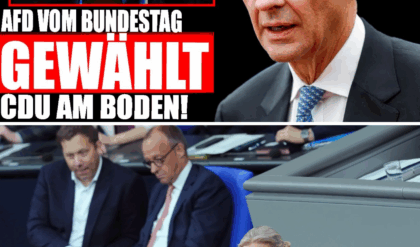💥 „Haben Sie was geraucht!?“ – Wie Tino Chrupalla eine ganze Talkrunde zum Schweigen brachte
Es war einer dieser Abende, an denen das deutsche Fernsehen zur Bühne eines politischen Schlagabtausches wird – eine Talkrunde, die eigentlich routiniert ablaufen sollte: ein Moderator, fünf Gäste, eine klare Frontlinie. Russland ist der Aggressor, Putin der Diktator, der Kriegsverbrecher – so das gewohnte Narrativ. Doch dann geschieht das, womit niemand gerechnet hatte: Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD, platzt der Kragen.

„Sag mal, haben Sie was geraucht!?“ – Mit diesem Satz bringt er nicht nur den Moderator aus dem Konzept, sondern legt auch das ganze Spannungsfeld offen, das derzeit die deutsche Debatte über Russland und den Ukraine-Krieg durchzieht.
Ein unerwarteter Moment der Rebellion
Während die Runde sich in Empörung über „den Aggressor Putin“ ergeht, hebt Chrupalla ruhig an. Kein Wutausbruch, keine Parole – zunächst nur eine nüchterne Analyse: „Wir haben hier drei Vokabeln benutzt: Diktator, Aggressor, Kriegsverbrecher. Was soll das politisch bewirken?“
Er spricht von Respekt. Von Diplomatie. Von Realismus. Russland sei eine Weltmacht, sagt er, und Präsident Putin ein gewähltes Staatsoberhaupt, mit dem man – ob man ihn mag oder nicht – reden müsse.
Da grummelt es in der Runde. Der Moderator, sichtlich genervt, will das Gespräch auf die moralische Ebene lenken. „Aber Herr Chrupalla, ist Putin denn kein Kriegsverbrecher?“ – Da fällt jener Satz, der in den sozialen Medien viral ging: „Sag mal, haben Sie was geraucht!?“
Ein Satz, der alles sagt. Über die Gereiztheit einer Debatte, die keinen Widerspruch mehr duldet.
Fünf gegen einen – und doch wirkt der Einzelne stärker
Die Szene entwickelt sich zu einer Art medialem Duell: fünf gegen einen. Doch Chrupalla lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit ruhiger Stimme erinnert er daran, dass auch westliche Staaten völkerrechtswidrige Kriege geführt haben. „Dann müssten ja viele amerikanische Präsidenten Kriegsverbrecher sein – einige haben sogar Friedensnobelpreise bekommen.“
Ein Stich ins Herz des moralischen Selbstbilds der westlichen Öffentlichkeit.

Der CDU-nahe Politologe in der Runde kontert sofort: Die AfD sei doch russlandfreundlich, sie lehne die NATO ab, wolle ein „eurasisches Reich“. Alte Ideen von Karl Schmitt, Alexander Dugin – gefährliche Gedankenspiele.
Doch Chrupalla bleibt sachlich: „Ein NATO-Austritt steht nicht in unserem Programm. Aber die NATO muss sich verändern. Sie ist längst kein Verteidigungsbündnis mehr.“
Er verweist auf die Multipolarität der Welt – auf China, Indien, neue Machtzentren. Der Westen, sagt er, müsse lernen, dass er nicht mehr allein das Maß aller Dinge sei. Und wieder: Empörung.
Doch zwischen den empörten Gesichtern liegt plötzlich etwas anderes: Ratlosigkeit.
Zwischen Realpolitik und Tabu
Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich diese Diskussion bewegt. Wer heute fordert, mit Russland zu reden, wird schnell als „Putin-Versteher“ diffamiert. Doch was ist mit den Interessen Deutschlands? Was ist mit Diplomatie, mit strategischer Vernunft?
Chrupalla stellt die unbequeme Frage: „Wie soll Putin an einen Tisch mit einem Kanzler kommen, der ihn öffentlich als Kriegsverbrecher bezeichnet?“
Eine einfache, fast naive Frage – und doch eine, die sitzt.
Denn jenseits aller Empörung bleibt sie bestehen: Wie will man Frieden schließen, wenn man den Gesprächspartner dämonisiert?
Die Rückkehr der Doppelstandards

Dann wendet sich das Gespräch der Nord Stream-Sabotage zu. Wieder diese offenen Wunden, die man lieber nicht berührt. Chrupalla erinnert daran, dass man anfangs Russland beschuldigte – und dass sich diese Anschuldigungen nicht bestätigten.
„Wir reden ständig von Fake News“, sagt er, „aber die größten Fakes kamen von unseren eigenen Medien.“
Er verweist auf die polnische Justiz, die Verdächtige nicht ausliefert, auf die Untätigkeit der Bundesregierung. Und er fragt, was viele denken, aber kaum einer laut sagt: Warum gilt moralische Empörung immer nur in eine Richtung?
Das Studio schweigt. Ein kurzer Moment Stille. Nur der Moderator versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen – vergeblich.
„Dürfen wir überhaupt noch stolz auf unser Land sein?“
Gegen Ende der Sendung driftet das Gespräch zur Wehrpflicht. Wieder wird es emotional. Chrupalla mahnt, dass man nicht über junge Menschen entscheiden dürfe, ohne sie zu fragen. „Was muten wir dieser Generation eigentlich zu?“
Er spricht von Patriotismus, von einem Land, dem man das Selbstbewusstsein aberzogen habe. „Dürfen wir überhaupt noch stolz auf unser Land sein?“, fragt er in die Runde.
Die Frage bleibt unbeantwortet. Der Moderator weicht aus, ein anderer Teilnehmer spottet. Doch im Publikum herrscht spürbares Unbehagen.
Ein Spiegel der Gesellschaft
Diese Talkrunde war mehr als nur ein politisches Streitgespräch. Sie war ein Spiegel der deutschen Seele im Jahr 2025: zwischen moralischer Selbstvergewisserung und wachsender Skepsis, zwischen Solidarität mit der Ukraine und dem Gefühl, dass Deutschland seine eigene Stimme verloren hat.
Chrupalla, der von vielen verachtet und von anderen bewundert wird, hat an diesem Abend eines gezeigt: dass die Debatte über Krieg, Frieden und nationale Interessen in Deutschland längst nicht mehr offen geführt wird.
Wer eine diplomatische Lösung will, gilt als Verräter. Wer von Realpolitik spricht, als Unmensch. Doch was, wenn gerade das moralische Pathos den Frieden verhindert?
Ein Europa der Angst oder der Vernunft?
Am Ende, als die Kameras schon fast ausgehen, sagt Chrupalla leise:
„Frieden ist keine Schwäche.“
Ein Satz, der kaum beachtet wird – doch vielleicht der wichtigste des Abends ist. Denn während Europa aufrüstet, während Medien weiter Feindbilder pflegen, erinnert er an etwas, das längst verloren scheint: an die Idee, dass Frieden durch Verständigung entsteht, nicht durch Waffenlieferungen.
Ein isoliertes Russland wird gefährlich bleiben. Ein eingebundenes Russland könnte sich verändern.
Das ist keine Beschwichtigung – das ist Realpolitik.
Fazit: Ein Tabubruch im besten Sinne
Was bleibt nach dieser Sendung?
Ein Publikum, das gespalten ist. Eine Medienlandschaft, die schäumt. Und ein Politiker, der mit einem einzigen Satz den Nerv einer ganzen Nation traf.
„Haben Sie was geraucht!?“ – Das war kein Ausrutscher, sondern ein Weckruf.
Ein Weckruf an jene, die glauben, Frieden entstehe durch moralische Überlegenheit. Ein Weckruf an die, die vergessen haben, dass Diplomatie auch mit denen beginnt, die man nicht versteht.
Vielleicht war dieser Abend der seltene Moment, in dem Fernsehen wieder Politikgeschichte schrieb – weil einer den Mut hatte, das Undenkbare zu sagen:
Frieden entsteht nicht durch Parolen. Sondern durch den Mut, das Gespräch zu suchen – selbst mit dem Feind.