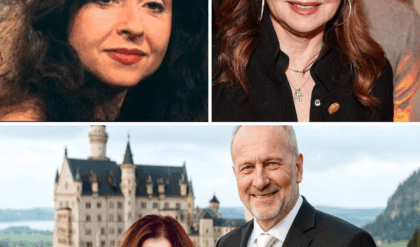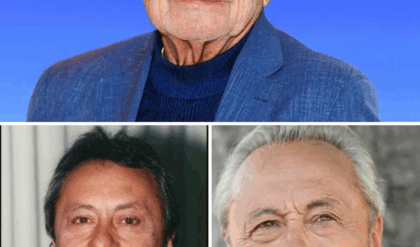Das Bild ist klein, beinahe unscheinbar: ein Bahnhof in Wanne-Eickel, die Straßenbahn quietscht, zwei Männer an der Theke. Genau hier, erzählt man, habe der kleine Heinz seine ersten Kunststücke gezeigt – nicht ganz freiwillig. Der Vater holte ihn aus dem Bett, setzte ihn vor die Gäste, damit der Vierjährige die Talente des Sohnes zur Schau stellte. Früh begann also die Bühne, und früh begann der Druck. Einige Kilometer weiter entdeckte der Junge eine zweite Liebe: das Fliegen. Auf dem 1912 eröffneten Flugplatz Wanne-Herten roch die Welt nach Öl und Benzin; Mechaniker, Piloten, Propeller – eine Faszination, die bleiben sollte, bis er später selbst die Kunstflugszenen in „Quax, der Bruchpilot“ flog.
Aufstieg und Absturz der Familie
1913 zieht die Familie nach Essen. Der Vater, nun Manager im neuen Hotel Handelshof, schwärmt von Münzautomaten, die ganze Familien ernähren könnten; das Bahnhofrestaurant galt als Goldgrube, die Küche der Mutter als Adresse mit gutem Ton. Der Wohlstand aber ist auf Sand gebaut. Nur zwei Jahre später folgt der Konkurs, 1915 – so heißt es – nimmt sich der Vater in Berlin das Leben. Zurück bleibt eine Witwe mit drei Kindern, die nach München geht, angelockt vom Ruf der erschwinglichen Stadt. In dieser Mischung aus Verlust und Neuanfang wächst Heinz Rühmann heran.
Der missmutige Oberkellner, der zum Schlüssel wird
Er verlässt das Gymnasium für den Traum vom Theater – und erlebt erst Hohn. Der schöne Liebhaber? Dafür sei er zu klein, zu unscheinbar, heißt es. In Breslau wird er gar „wegen Talentlosigkeit“ entlassen. Dann, ein Zufallsmoment 1922 am Residenztheater Hannover: Aus Frust spielt er einen Oberkellner mit grummelnder Lässigkeit – das Publikum tobt. In dieser Widerborstigkeit findet Rühmann seinen Ton: den lakonischen, leicht mürrischen, der die Herzen gewinnt, weil er das Menschliche groß macht.
Tonfilmwelle und Durchbruch
Bis 1930 hat er nur zwei Stummfilmauftritte – kleine Brotjobs. Der Tonfilm wird sein Katalysator. Produktionsleiter Erich Pommer besetzt ihn in „Die Drei von der Tankstelle“ an die Seite von Willy Fritsch und Oskar Karlweis. Der Erfolg katapultiert Rühmann über Nacht in den Status des beliebtesten deutschen Schauspielers. Zwischen 1930 und 1945 spielt er in 49 Filmen: „Kleider machen Leute“, „Quax, der Bruchpilot“, „Die Feuerzangenbowle“. Sein Sprechstil – niedrig moduliert, beiläufig – wird zur Marke.
Leben und Lieben im Schatten der Zeit
Privat ist Rühmann ein Mann der Nähe – und der Unruhe. Früh liebt er die Kollegin Maria Bernheim, die 1925 ihre Stelle aufgibt, seine „Privatdirektorin“ wird. Später, in Berlin, beginnt er eine Beziehung mit Leni Marenbach. In den 1930er Jahren wird die Ehe mit Maria politisch: Die Frage, ob der populäre Filmschauspieler mit einer Jüdin verheiratet sei, wird zur öffentlichen Causa. Rühmann sucht den Rat von Hermann Göring; 1938 wird die Ehe geschieden, Maria heiratet den schwedischen Schauspieler Rudolf von Nauckhoff und kann 1943 emigrieren. Rühmann unterstützt sie weiter finanziell, beide treten nach dem Krieg gemeinsam im Fernsehen auf und sprechen darüber, wie politischer Druck sie trennte.

1939 heiratet Rühmann die Wiener Schauspielerin Hertha Feiler, die nach Nürnberger Gesetzen als „Vierteljüdin“ gilt – Joseph Goebbels erteilt der Ehe seinen Segen. 1970 stirbt Hertha Feiler an Krebs. Wenige Jahre später verliebt sich die Verlegerwitwe Hertha Drömer während eines Alpenflugs in den Mann am Steuer; 1974 werden sie und Rühmann ein Paar und führen bis zu seinem Tod ein zurückgezogenes Leben in Aufkirchen am Starnberger See. „Er mochte es nicht, allein zu sein“, wird sie später sagen.
Ambivalenz im „Dritten Reich“
Rühmann ist das Musterbeispiel eines Künstlers, der im NS-Staat populär wird, ohne je als eifriger Nationalsozialist aufzufallen. Goebbels’ Tagebücher schwanken zwischen Rüge und Lob: mal „nicht besonders gut, aber kriegsnützlich“, mal „benimmt sich unverschämt“. Dass Unterhaltung stabilisiert, machen die Machthaber sich zunutze; Rühmann steht am Ende auf der „Gottbegnadeten-Liste“. Dank seiner Kontakte darf der leidenschaftliche Pilot auch im Krieg weiter fliegen. „Die Feuerzangenbowle“ feiert am 28. Januar 1944 Premiere – mitten im Inferno. Das Melancholische, das Nostalgische dieses „Rettungsraums“ wird zum kollektiven Trostbild.

Nachkrieg, Kultstatus, Kontinuität
1945 verbieten die Alliierten ihm vorübergehend die Filmarbeit, doch 1946 stellt die Entnazifizierung fest, dass nichts gegen seine Rückkehr spricht. Rühmann macht nahtlos weiter, dreht bis in die frühen 1990er Jahre Kino- und Fernsehfilme, baut auf Komödie („Charleys Tante“) und Ernst („Der Hauptmann von Köpenick“, „Es geschah am hellichten Tag“, „Der brave Soldat Schwejk“). Er wird zu Pater Brown, dreht in Hollywood „Das Narrenschiff“, steht mit „Tod eines Handlungsreisenden“ für seine Tragfähigkeit als Charaktermime.
„Die Feuerzangenbowle“ bleibt der Magnet: Als das ZDF den Film am 26. Dezember 1969 erstmals zeigt, sehen 20 Millionen zu; an Universitäten wird die Vorführung vor Weihnachten zur Tradition. So tief sitzt das Bild des schelmischen Überlebenskünstlers in der deutschen Erinnerung.
Die leise Stimme, die alle mitsingen lässt
Sänger im klassischen Sinne war Rühmann nicht – und doch war da diese heiser-leichte Sprechmelodik, die an heutigen Maßstäben beinahe wie früher Rap wirkt. „Jawohl, meine Herren“, „Ein Freund, ein guter Freund“ oder das Wiegenlied „La-Le-Lu“: Lieder, die hängen bleiben, weil sie nicht brillieren wollen, sondern sich neben einen setzen. 1993 schafft eine Neuauflage von „La-Le-Lu“ es noch einmal in die Charts.
Krieg, Verlust, Weitergehen
Der Krieg zeichnet auch Rühmann. 1944 gerät er, so wird berichtet, in sowjetische Gefangenschaft und erlebt Monate in einem sibirischen Lager – Erinnerungen an Schrecken und den Wert des Friedens ziehen sich durch seine späten Worte. Ein weiterer Bruch ist der Tod seines Sohnes Peter, der 1952 bei einem Autounfall ums Leben kommt. Rühmann arbeitet weiter – nicht trotzig, eher suchend; Arbeit als Halt.
Der späte Herr, der noch einmal fliegt
In seinen Siebzigern steht er im Wiener Burgtheater, an den Münchner Kammerspielen, spielt einen Clown im Zirkus Krone, liest zu Weihnachten in der Hamburger Michaeliskirche. Und immer wieder das Cockpit. 1993 steht er in Wim Wenders’ „In weiter Ferne, so nah!“ vor der Kamera – einer, der noch im Stummfilm begonnen hatte und in den 1990ern immer noch da ist. „Ich glaube nicht, dass ich ein mutiger Mann war“, sagt er in einer späten Rolle zu seinem Schutzengel – ein Satz, der wie ein Schlüssel klingt.
Abschied und Vermächtnis
Am 3. Oktober 1994 stirbt Heinz Rühmann in Aufkirchen am Starnberger See, 92 Jahre alt. Die genaue Todesursache wird nicht veröffentlicht; man spricht von Altersschwäche. 1995 erhält er posthum die Goldene Kamera als „größter deutscher Schauspieler des Jahrhunderts“. Auf dem Friedhof von Aufkirchen wird sein Grab bis heute besucht und gepflegt.
Warum er bleibt
Vielleicht bleibt Rühmann, weil er die Illusion einer heilen Welt nie naiv erzählte. Seine Figuren waren kleine Überlebenskünstler: verwundet, aber nicht verbittert; witzig, aber nicht zynisch. Diese Mischung – Leichtigkeit als Form der Lastbewältigung – traf das Deutschland der dreißiger Jahre ebenso wie das der Nachkriegszeit. Die Ambivalenz seiner Rolle im „Dritten Reich“ bleibt Teil seiner Geschichte. Doch in der Summe steht da ein Künstler, der seine Zeit spiegelte, ohne zu predigen; der Nähe suchte, im Leben wie im Spiel; der seine leise Stimme fand – und damit Millionen zum Mitsingen brachte.